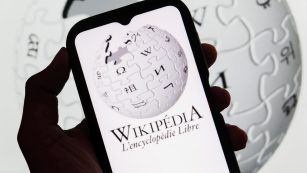Wie kann man diese Bewegung in Israel nur verstehen? Da gehen 300.000 mittelständische und großteils jugendliche Bürger auf die Straße und sprechen eine schon fast vergessene Sprache. Die politische Sprache Israels hat die wirtschaftliche Wende vollzogen. Nicht von Sicherheit und Terror ist die Rede, sondern »das Volk will soziale Gerechtigkeit«, wie es nun von allen Plätzen der Städte verkündet wird.
Was will das Volk? Und was meint es wohl mit sozialer Gerechtigkeit? Ist das die israelisch-französische Revolution, geht es um die längst überfällige und an Israel vorbeigegangene 68er-Bewegung oder geht es um die Angst des Mittelstands, in Armut zu fallen? Welchen Staat haben die Protes-tierenden im Auge, wenn sie nach dem Sozialstaat rufen?
Staatsgründung Die Demonstranten in Israel leben natürlich auch in der Illusion einer besseren Vergangenheit. Damit sind sie nicht alleine auf der Welt. Die lange hegemonial herrschende Sozialdemokratie in Israel hat es immer verstanden, die Gesellschaft als einen auf Gleichheit beruhenden Sozialstaat darzustellen. Das war sowohl für die Staatsgründung als auch für die Staatserhaltung in den ersten Jahrzehnten ein mehr als wichtiger Mythos. Und vieles daran stimmte auch.
Es gab weniger, und dieses Weniger war breiter verteilt. Soziale Unruhen kannte man in Israel auch in den 50er- und 60er-Jahren. Damals waren es aber die orientalischen Juden, die so leben wollten wie ihre aus westlichen Ländern stammenden Mitbürger. Heute sind diese Unterschiede im Vergleich zu früher kleiner geworden. Aber darum geht es nicht.
Die Demonstranten wollen nicht den real existierenden Wohlfahrtsstaat von früher. Sie sind sich aber auch der Tatsache bewusst, dass es heute in Israel mehr Chancengleichheit gibt als früher. Viele der Demonstranten sind Studenten, und auch sie wissen, dass der Zugang zu einer höheren akademischen Bildung heute leichter ist als vor etwa 20 Jahren. Gerade wegen der besseren Chancen sind sie auf der Straße.
Luxus Sie wollen so leben, wie sie glauben, dass ihre Altersgenossen außerhalb Israels im Westen leben. Sie wollen Normalität, bezahlbare Mieten, freie Kitas, gute Universitäten, ein funktionierendes Gesundheitssystem, Urlaub im Ausland, die bürgerliche Normalität des bezahlbaren Luxus, den es fast schon nirgends mehr gibt. Es ist der amerikanische Traum, gut verpackt im europäischen Sozialstaat. Man will wieder Kontrolle über das eigene Leben haben, die von so vielen Menschen gespürte Hilflosigkeit bremsen.
Natürlich ist auch in Israel eine universalistische Gesellschaftstheorie der Individualisierung nicht möglich. Da ist Israel nicht viel anders als anderen Staaten. Junge Israelis bewegen sich eher in weitmaschigen Netzwerken, in denen die Grenzen der Zugehörigkeit anders geschnitten sind, als es frühere Unterscheidungen zwischen Links und Rechts zulassen können.
Gemeinschaft ist keine Rückkehr zu einer imaginären Vergangenheit, in der alles einmal besser war. Das wissen auch die Demonstranten. Es geht ihnen nicht darum, die Sozialdemokratie wieder künstlich beatmen zu wollen. Das ist auch in Israel nicht mehr möglich.
Zu viele lose Netzwerke sind in dieser Bewegung vertreten, (zu) viele Forderungen, die weder koordiniert sind noch sich überschneiden können. Die Grenzen der Zugehörigkeit sind eher undurchsichtig und haben mit der nationalen und ethnischen Gleichartigkeit der alten Sozialdemokratie nicht viel gemein. Die Jugendlichen laufen den politischen Parteien davon und ändern damit auch die politische Sprache des Landes.
Hauptlast Die jungen Israelis sind empört darüber, dass sie zu hohe Steuern zahlen, zu wenige Dienstleistungen dafür bekommen, dass zu wenige die Hauptlast des Staates tragen. Einige sind auch über die seit 1967 andauernde Besatzung empört, aber die Demonstranten wollen den Bezug zwischen den hohen Lebenshaltungskosten und der Besatzung noch nicht herstellen. Denn dies würde die Bewegung sofort in die altbekannte Zweiteilung zwischen Links und Rechts aufbrechen lassen.
Aber darum geht es in der Tat nicht. Es geht weder um Besatzung noch um Sozialstaat. Es geht um das Sowohl-als-auch. Die Menschen trauen den alten Institutionen nicht mehr. Und warum sollten sie auch? Es fehlt eine klare Perspektive, mit der junge Israelis ihrer Existenz einen Sinn geben können: Auf der einen Seite eine von Feinden umzingelte Besatzungsmacht und auf der anderen Seite der ständige Vergleich, dass man auch normal(er) leben kann und will. Da wird dann der Mythos des eingebildeten Wohlfahrtsstaats von früher als Symbol für die ungewisse Zukunft benutzt.
Aber gleichzeitig ist es keine entgrenzte Empörung wie in London. Man will nur retten, was eigentlich nicht mehr zu retten ist. Die konstanten Koordinaten des sozialen Wandels existieren wohl nicht mehr, den nie existierenden Sozialstaat wird es wohl auch in Zukunft nicht geben. Trotzdem oder sogar deswegen ist Israel im Moment demokratischer, als es je war.
Der Autor ist Professor für Soziologie und lehrt am Academic College of Tel-Aviv-Yaffo.