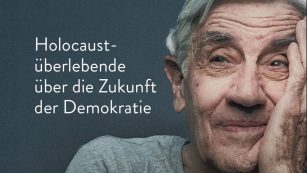Eigentlich müssten die leichthändigen und geistreich-verspielten Romane des Argentiniers Ariel Magnus landauf, landab gelesen werden. Eigentlich. Dabei sind bisher von seinen 21 Büchern nur fünf ins Deutsche übersetzt worden.
Magnus, 1975 in Buenos Aires als Enkel von Holocaust-Überlebenden geboren, studierte Literatur und Philosophie in Heidelberg und Berlin, kehrte dann in seine Geburtsstadt zurück und lebt seit einigen Jahren wieder in Berlin, zusammen mit seiner Frau Mariana Dimópulos, Autorin und Übersetzerin von Walter Benjamin und dem südafrikanisch-australischen Literaturnobelpreisträger John M. Coetzee.
Ein guter Anfang der Magnus-Lektüre ist das Buch Die Schachspieler von Buenos Aires. Der 2018 auf Deutsch erschienene Roman setzt so ein: »Dieser Roman ist von der ersten bis zur letzten Zeile ein Werk der Fiktion.« Und: »Absolut real ist schließlich, dass es in Stefan Zweigs ›Schachnovelle‹ eine fiktive Figur namens Mirko Czentovich gibt.«
Jonglieren mit Wirklichkeit und Erfindung
Was sich anschließt, ist ein Jonglieren mit Wirklichkeit und Erfindung, mit Literatur und dem Leben des Großvaters, Heinz Magnus aus Hamburg, der sich nach Argentinien rettete, selbst Autor werden wollte und 1940 in Buenos Aires Stefan Zweig als Redner erlebte. Ariel Magnus fielen die Tagebücher des Großvaters nach dessen Tod zu. Diese führte er mit der Schach-Olympiade (Ende August bis Mitte September 1939) in Buenos Aires zusammen, in deren Verlauf Nazi-Deutschland den verheerendsten Krieg aller Zeiten vom Zaun brach.
Nun legt Magnus seinen jüngsten Roman vor – in einem anderen Verlag, nicht bei Kiepenheuer & Witsch in Köln, sondern im kleinen Berliner Haus mikrotext. Und: Es ist die erste gedruckte erzählende Prosa von ihm, die er auf Deutsch schrieb.
Magnus macht dem größten Freiraum Berlins eine Liebeserklärung.
So wie einst Vladimir Nabokov, der in den 1920er-Jahren in Berlin lebte, infolge seiner Emigration in den 30er-Jahren in die USA als Autor vom Russischen ins Englische hinüberwechselte und bald einer der raffiniertesten Stilisten der Moderne wurde, erweist sich Magnus als Deutsch Schreibender sehr vielen Muttersprachlern haus-, ja fernsehturmhoch überlegen. Derart viele geistreiche Sprachspiele, parodistische Verfremdungen und ironische Travestien kann man vielleicht nur dann auf Papier bannen, ganz zu schweigen von: erfinden, wenn man ein hochsensibles Gehör und Gespür für die zweite Sprache entwickelt hat.
Das Buch spielt auf dem vormaligen Flughafen Tempelhof, bekannt geworden erst als NS-Prestigebau, dann 1948 durch die Luftbrücke der Alliierten, mit der West-Berlin versorgt wurde. 2008 wurde dort der zivile Flugverkehr eingestellt, seither ist es eine große Grün-, Sport- und Erholungsfläche. 2014 wurde durch einen Volksentscheid eine flächendeckende Bebauung untersagt, neuerdings gibt es seitens des Berliner Senats jedoch wieder Bestrebungen für architektonische Planungen.
Der israelische Bäcker Yehonatan wird für seine Brezeln gerühmt
Magnusʼ Roman kreist um das Feld und ein Quartett, dessen Existenz fragil ist und dessen »Mitglieder« auf dem riesigen Grün oder ganz nahebei leben: der Syrer Jamil, der als Illegaler in einem aufgelassenen Container haust, sein Freund Santiago, von allen »Santi« genannt, der im Rollstuhl sitzt, die Asylbewerberin Elenya, die in Syrien Untergrundkämpferin war und die schließlich Figur Nr. 4, den israelischen Bäcker Yehonatan (der für seine Brezeln gerühmt wird) heiratet. Der gärtnernde Herr Schwarz spielt als einziger Deutscher eine marginale Rolle.
Als hätte sich Samuel Beckett mit dem Woody Allen der 70er-Jahre auf eine Flasche Jameson Irish Whiskey getroffen, und zu ihnen hätten sich Groucho Marx und Mel Brooks gesellt, so liest sich diese hinreißende Prosa mit grandiosen Dialogen, in denen es so urkomisch wie bitter kalauernd um Leben, Entwurzelung, Extremismus, Hass, Anerkennung, Freundschaft und Liebe geht.
Die Figuren: ein Syrer, ein Israeli, ein Rollstuhlfahrer und eine Freiheitskämpferin.
Der Makrokosmos des Tempelhofer Feldes hält alles zusammen. In vielen Episoden promenieren, räsonieren, parlieren die Romanfiguren über das 355 Hektar große Areal. Wunderbar spießt Magnus teutonische Eigenheiten auf, das Freizeitverhalten, amourös Skurriles, sozial voneinander Scheidendes. Aber auch die Skuddenschafe, die »lebenden Rasenmäher«, kommen zu ihrem rechtmäßig abgefressenen Raum.
Zugleich ist das Buch eine große Liebeserklärung an den größten Freiraum der Hauptstadt und in intellektueller Hinsicht an Freiheit und episches Erzählen. Dabei ist dieser Band hochpolitisch. Schließlich sind die Protagonisten marginalisiert, stehen am Rand oder kommen von den Rändern niemals ins Zentrum der Gesellschaft.
Jamil, der Illegale, verlässt das Feld nur einmal bei einer Fahrt durch Berlin – und setzt bezeichnenderweise dabei keinen Fuß auf den Boden außerhalb des Tempelhofer Felds. Dieses weite Feld ist ein Spiegel und gleichzeitig ein Zerrspiegel, in dem die Politik der vergangenen Jahre in Deutschland und in Europa mit luzider Klarheit porträtiert wird.
So ungebärdig lustig, pikaresk und abgründig fabulierte zuletzt, vor mehr als einer Generation, der Schriftsteller Edgar Hilsenrath. Die Verbliebenen vom Tempelfeld ist vielleicht der große komische Berlin-Roman dieses Jahrzehnts.
Ariel Magnus: »Die Verbliebenen vom Tempelfeld«. mikrotext, Berlin 2025, 248 S., 25 €