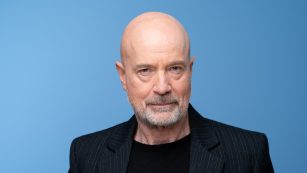Marko Dinićs Buch der Gesichter ist ein Wagnis, und zwar eines, das es auf die diesjährige Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat. Es ist nach Die guten Tage von 2019 Dinićs zweiter Roman. Geboren wurde der Autor 1988 in Wien, aufgewachsen ist er in Serbien, 2016 war er Teilnehmer des Ingeborg-Bachmann-Preises. Buch der Gesichter ist wie ein bewusst gesetzer Stein des Anstoßes, eine fast in Kauf genommene Überforderung. Denn die Geschichte der Juden in Serbien ist lang, komplex und mit der von vielen anderen Minderheiten im Land ebenso verknüpft wie mit der Verfolgung und Ermordung der Juden in Ost-, in West- und Südeuropa.
Natürlich gab es die auch ins Deutsche übersetzten Bücher von Überlebenden wie Ivan Ivanji und József Debreczeni, die trotzig gegen das Vergessen angeschrieben haben. David Albahari, der in den 90er-Jahren dem Verband der jüdischen Gemeinden Jugoslawiens vorstand, ist ebenso zu nennen wie der serbisch-jüdische und in Deutschland erst spät entdeckte Schriftsteller Aleksandar Tišma mit seiner 2021 erschienenen Autobiografie Erinnere dich ewig, nicht zu vergessen der 1989 in Paris verstorbene Danilo Kiš.
Doch ein zeitübergreifender Roman zur serbisch-jüdischen Existenz, der Vertreibung, Verfolgung sowie Ermordung thematisiert, fehlte bisher – zumindest in deutscher Sprache. Jetzt schreibt Marko Dinić, der heute in Österreich lebt, in Salzburg Germanistik und Jüdische Kultur studiert hat, nicht über die vergangenen zwei Jahrtausende. Er konzentriert sich auf das 20. Jahrhundert, die beiden großen Kriege sowie das Davor, Danach und Dazwischen.
Ein zeitübergreifender Roman zur serbisch-jüdischen Existenz, der Vertreibung, Verfolgung sowie Ermordung thematisiert, fehlte bisher.
Die Fäden, die er dabei aufnimmt, reichen aber in alle Richtungen, zeitlich wie örtlich, verwirren und verweben sich, vermitteln letztendlich auch ein Abbild all der anderen Minderheiten, die sich vor allem in und um Belgrad herum angesiedelt hatten. Über einen der Protagonisten ist zu lesen: »Er unterschied sein eigenes Deutsch vom Jiddisch der Händler in der Dubrovačka, deren Serbisch rauer klang als das Ijekavische der Kroaten, dem das Bosnische glich. Er beneidete die osmanischen Gewürzhändler um deren türkischen Singsang, wogegen die Ruthenen spuckten, wenn sie einen Juden sahen!«
Unter der deutschen Okkupation wird Serbien im Sommer 1942 für »judenfrei« erklärt
Dinić geht die Sache von unten an, aus dem Blickwinkel der sehr Geschundenen, Gejagten und Verfolgten, der von Anfang an Verlorenen und dennoch um ihr Leben Kämpfenden. »Der Krieg, bisher nur als Wunsch nach Erneuerung in den Köpfen der Menschen mäandernd, war eine Totgeburt.« Buch der Gesichter breitet sich vor dem Lesenden über 450 Seiten wie ein in Blut und Dreck getränktes, zerrupftes und gehetzt gewebtes Stück Stoff aus. Bilder, Beschreibungen widern manchmal an – und sollen das wohl auch ganz bewusst. Es ist Erinnerungsliteratur, die geschrieben werden wollte, jetzt, solange sich noch irgendjemand erinnert, jetzt, bevor sich Ausblendung, Nichtwissen, Lücken im Bewusstsein festsetzen.
Unter der deutschen Okkupation wird Serbien im Sommer 1942 für »judenfrei« erklärt. Der Tag dieser radikalen Deklaration steht zentral und kapitelübergreifend in Dinićs Buch. 24 Stunden dehnen sich aus, weiten sich, bieten Platz für einen Handlungsstrang, entlang dessen es um die Suche nach einer »arabesk ornamentierten« Haggada und einer Mutter geht, die dieses Büchlein, um es zu retten, unter Fußbodendielen versteckt hatte. Der Junge Isak und seine Mutter Olga sind die letzten Juden in Zimony, dem jüdischen Viertel Belgrads. Ihr ohnehin schweres Leben ist seit dem Ende des Ersten Weltkriegs zusehends härter geworden. Dazu kommt nun die tagtägliche Angst, als Juden drangsaliert zu werden.
Die Belgrader Synagoge ist zu einem Bordell geworden.
Als Olga verschwindet, nehmen sich das Anarchistenpaar Rosa und Milan des Jungen an. Aus Isak wird Ivan, der, erwachsen geworden, in dem von den Deutschen besetzten Belgrad beginnt, nach Mutter, Haggada und eigener Identität zu suchen. Die Wirren der Ereignisse, ihre Brutalität bespiegelt Dinić aus unterschiedlichen Perspektiven.
Der Autor gibt auch einem serbischen Beamten und Kollaborateur namens Mirko Dinić einen Auftritt
Dabei kann es kein Zufall sein, dass der Autor auch einem serbischen Beamten und Kollaborateur namens Mirko Dinić einen Auftritt gibt. Die Belgrader Synagoge ist zu einem Bordell geworden, der zwielichtige Mirko sitzt in böser Erwartung, gefoltert zu werden, im Keller eines Gestapo-Gefängnisses, stößt da auf Isak, hört, wie dieser anderen über seine heimliche jüdische Identität erzählt. In der Hoffnung, der Folter zu entkommen, gibt Mirko das an die Deutschen weiter. Aber niemanden interessiert es, was Mirko da plappert. Einige Figuren im Buch bleiben nur schemenhaft, bewegen sich wie camoufliert durch eine völlig desolate Landschaft.
Manchmal hätte man sich mehr Lektorat gewünscht, beispielsweise um die etwas willkürlich gestreuten Ausrufungszeichen zu streichen oder zur Korrektur seltsamer Metaphern und Redewendungen. Jemand beißt da ins »Fleisch eines Apfels wie in eine Wunde«, und eine Jüdin – voller Angst, deportiert zu werden – spricht davon, vielleicht die Nächste zu sein, »die gegangen wird«. Die Einheitlichkeit von Sprachstil und Erzählhaltung geht im Verlauf des Buches manchmal verloren, als hätte es dem Autor gegen Ende am langen Atem gefehlt. Ein Wagnis bleibt ein Wagnis. Dass Dinić es einging, ist gut.
Marko Dinić: »Buch der Gesichter«. Zsolnay, München 2025, 464 S., 28 €