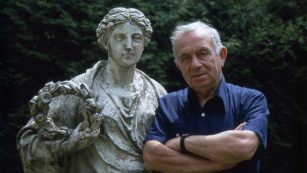Frau Modan, soeben ist Ihre Graphic Novel »Das Erbe« erschienen. Darin erzählen Sie die Geschichte einer Familie, die auf der Suche nach dem früheren Haus der Familie nach Polen fährt. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
Meine Familie stammt ursprünglich aus Warschau und ging noch vor dem Zweiten Weltkrieg nach Israel. Die Geschichte des Buches hängt also eng mit meiner Familie zusammen. Aber nicht nur mit meiner. Viele Israelis haben polnische Wurzeln. Nach dem Krieg war Polen ein kommunistisches Land – jegliches Eigentum wurde verstaatlicht. Und für viele Jahre konnte man nicht dorthin zurückkehren. Das Land war quasi abgeschlossen.
Das hat sich längst geändert.
Ja, aber damals sprach man nicht über das Land. Viele Menschen hatten traumatische Erinnerungen an Polen. Meine Großmütter nannten Polen immer einen großen Friedhof. In den vergangenen zehn Jahren hat sich das verändert. Es gibt eine neue Generation, die andere Erinnerungen hat und die wissen will, woher sie kommt. Erst langsam kehren Menschen nach Polen zurück und erkundigen sich nach ihren ehemaligen Wohnungen oder Häusern und nach ihrer Vergangenheit.
Wann haben Sie angefangen, sich für Polen zu interessieren?
Na ja, ich war nicht besonders neugierig darauf und habe das Land nicht als meine Heimat betrachtet. 2007 habe ich meinen Blog »Mixed Emotions« für die Website der New York Times geschrieben. Es waren persönliche Geschichten, und jeder Eintrag war einem Familienmitglied gewidmet. Ein Blogbeitrag handelte von meinen Großmüttern, denen ich nicht sehr nahestand.
Warum?
Sie waren sehr schwierig. Ungefähr so wie Regina in »Das Erbe«. In meinem Blog habe ich versucht, meine Großmütter als fremde Menschen zu sehen, nicht als meine Großmütter. Die Leser haben sehr herzlich auf diese Geschichten reagiert. Nicht nur Juden – auch Koreaner, Japaner oder Italiener haben mir geschrieben, dass ihre Omas genauso gewesen sind wie meine. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass jeder irgendwie eine »Jiddische Mamme« hat. Das ist nichts spezifisch Jüdisches – es ist eine allgemeine Erfahrung. Diese Erfahrung hat mich auch zu meiner Geschichte inspiriert. Eigentlich wollte ich gar nicht, dass sie ein Road Trip wird. Und ich wollte auch nicht »Maus 2« schreiben. Meine Großmütter sollten keine Opfer sein. Denn wenn sie das gewesen wären, hätte ich mich ihnen nicht so gut nähern können.
Sind Sie selbst nach Polen gefahren?
Ja, für eine Woche. Vor meiner Reise habe ich viel darüber gelesen, anfangs bei Wikipedia. Und ich war erstaunt, wie wenig ich über das Land wusste, aus dem meine Familie kam. Für mich war klar: Wenn ich ein Buch über das heutige Warschau schreiben will, muss ich dorthin fahren. Ich hatte nämlich gar keine Vorstellung, wie es dort ist. Das ist bei Städten wie Paris anders. Da weiß man, wie es aussieht, auch wenn man noch nie da gewesen ist.
Wie war Ihr Aufenthalt?
Sehr interessant. Ich habe viele Menschen getroffen, Ihnen Fragen gestellt. Eine Frau hat mir vom Tag der Toten erzählt, an dem die Friedhöfe voller Kerzen sind. Familien besuchen ihre Angehörigen, das hat mich fasziniert. Außerdem wollte ich nicht nur die üblichen Orte aufsuchen. Ich wollte mich mit jungen Leuten treffen, ihre Geschichten hören und das heutige Warschau erleben.
Hat Ihnen das Nichtwissen, von dem Sie vorhin sprachen, geholfen?
Es war ein Abenteuer, denn heutzutage ist es sehr schwer, irgendwohin zu gehen, ohne vorher schon ein komplettes Bild im Kopf zu haben. Ich habe auch nicht bei Google nach Bildern von Warschau gesucht. Ich wollte einen frischen Eindruck haben. Warschau ist keine sehr schöne Stadt, aber ich habe mich dort sehr wohlgefühlt. Sie hat mich auch ein bisschen an Tel Aviv erinnert, obwohl die Stadt eigentlich überhaupt nicht so aussieht. Aber die Atmosphäre war ähnlich. Vielleicht liegt es daran, wie die Läden aussehen oder wie die Leute miteinander umgehen. Es gibt mehr Gemeinsamkeiten zwischen der polnischen und der israelischen Kultur, als Israelis glauben.
Haben Sie Ihre Familie nach der Rückkehr mit Ihren Erfahrungen konfrontiert?
Ich habe meine Onkels gefragt, die in Israel geboren sind, aber noch die alten Familiengeschichten kannten. Allerdings haben sie nie darüber gesprochen, sie haben mit diesem Kapitel abgeschlossen. Ich merkte: Es gab vielleicht zwei, drei Geschichten, die meine Großmutter zu jeder passenden Gelegenheit erzählt hat. Die jedoch handelten davon, wie begehrt sie war, was für eine gute Schülerin, wie schön sie als junge Frau war. Also musste ich noch ein bisschen nachforschen. Das Schöne an Literatur ist ja, dass man Dinge auch erfinden kann.
Die Handlung von »Das Erbe« erstreckt sich über sieben Tage. Warum diese Zahl?
Die Sieben ist sehr symbolisch. Aber ich habe es nicht bewusst auf Symbolik angelegt. Ich habe mich für Wochentage statt Kapitel entschieden, weil die meisten Leute normalerweise für eine Woche nach Polen fahren.
Sie haben mit »Exit Wounds« einen viel beachteten Erstling vorgelegt. Wie war es, dieses zweite Buch zu schreiben?
Beängstigend, weil es der zweite Roman ist. Ich hätte ja bei »Exit Wounds« auch einfach Anfängerglück gehabt haben können. Wenn ich arbeite, versuche ich nicht daran zu denken, wer das Buch lesen wird. Ich denke allein an das Buch und an die Geschichte. In »Das Erbe« stecken drei Jahre Arbeit.
Was sind Ihre Einflüsse?
Die Frage hätte ich in jüngeren Jahren einfacher beantworten können. Hergé, Winsor McCay, Art Spiegelman ... ich könnte so viele nennen.
Es gibt viele Graphic Novels, die sich mit der Schoa und dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen. Ist die Graphic Novel das richtige Medium, um diese Themen zu vermitteln?
Ich habe darüber noch nicht genauer nachgedacht. Als »Maus« veröffentlicht wurde, waren viele Menschen der Meinung, dass man die Schoa nicht in Comic-Form wiedergeben kann. Vielleicht liegt es daran, wie man die Graphic Novel macht. Nicht von allen Ereignissen gibt es Fotos oder Filmaufnahmen. Und etwas Gemaltes ist auch immer eine Interpretation. Man kann Details, die vielleicht nicht dokumentiert wurden, genauer betrachten. Zeichnen ist immer abstrakter als Fotografie. Und diese Abstraktion ist expliziter. Es hilft also, Geschichten und Ereignisse zu erzählen, wo Filme enden, wo etwas zu schwer zu ertragen ist. Das ist nicht nur mit Schoa-Themen so. Marjane Satrapi hat in ihrem Comic »Persepolis« Enthauptungen gezeichnet. Das als Film zu sehen, wäre schrecklich. Man darf aber nie vergessen, dass Gräueltaten wirklich geschehen – auch wenn sie gezeichnet sind.
Mit der Autorin sprach Katrin Richter.
Rutu Modan: »Das Erbe«. Aus dem Hebräischen von Gundula Schiffer. Carlsen, Hamburg 2013, 224 S., 24,90 €