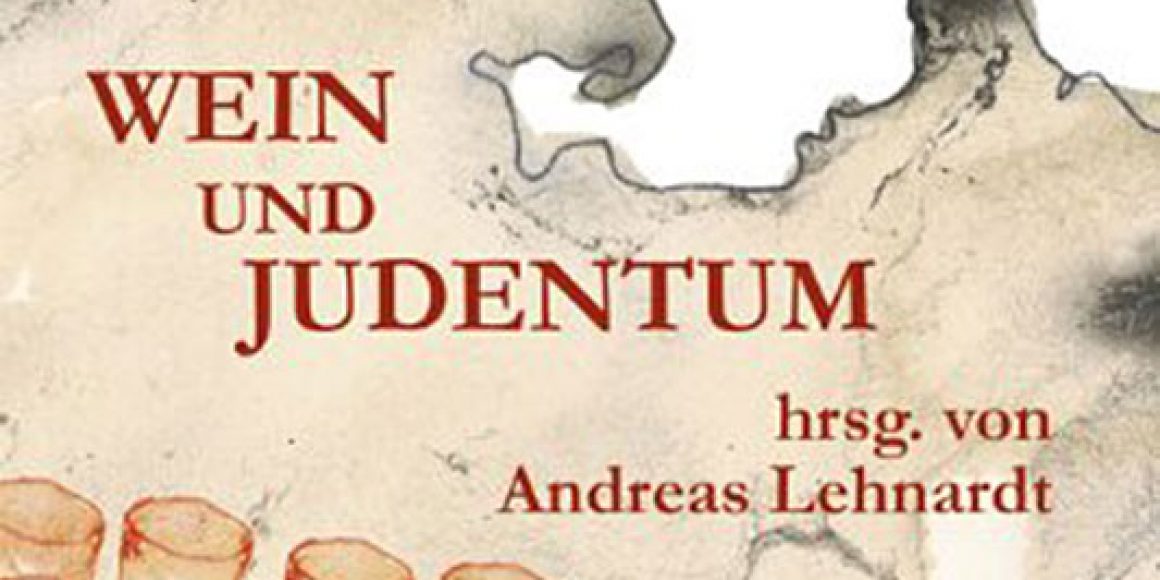Für viele, auch für keineswegs besonders fromme Juden ist der »Kiddusch«, also die feierliche Heiligung von Wein in einem meist silbernen Becher, der Inbegriff häuslicher und synagogaler Frömmigkeit nach dem Gottesdienst oder vor der Schabbatmahlzeit zu Hause.
Und dennoch ist das Verhältnis des Judentums zum Alkoholgenuss zwiespältig, scheinen Juden insgesamt weniger zu trinken als Christen – wenn auch mehr als Muslime, denen der Alkoholgenuss gänzlich untersagt ist. Allenfalls an Purim, also jenem Fest, an dem im Maskentaumel ohnehin das Oberste zuunterst gekehrt wird, sollen jedenfalls die Männer so viel trinken, dass sie nicht mehr wissen, wer Mordechai und wer Haman ist.
Konferenz Genauere Auskunft gibt jetzt der von dem Mainzer Judaisten Andreas Lenhardt herausgegebene Band Wein und Judentum, der die Beiträge einer gleichnamigen Konferenz gut lesbar zugänglich macht. Der Band widmet sich seiner Thematik in drei zeitlichen Abschnitten: der Antike und Spätantike, dem Mittelalter und der frühen Neuzeit sowie der Neuzeit.
Die späte jüdische Antike war nicht nur – wie der Beitrag von Susanne Plietzsch zeigt – mit der Frage befasst, was zwischen dem betrunkenen Noah und seinem Sohn Ham vor sich ging, sondern vor allem mit der Frage, ob jüdische Frauen Wein trinken dürfen.
Die Berliner Judaistin Tal Ilan weist nach, wie besonders misstrauisch die rabbinischen Weisen dem Weingenuss jüdischer Frauen gegenüberstanden – als echte Patriarchen fürchteten sie die Sitten lösenden Kräfte des Weins. So sagte etwa Rabbi Hiya bar Adda, dass man Frauen keinen Wein geben solle, denn: »Hurerei, Wein und Most nehmen den Verstand«.
Wein wurde, so der Nachweis der Düsseldorfer Judaistin Farina Marx, einerseits argwöhnisch betrachtet, andererseits ob seiner begeisternden Kraft auch von den Rabbinen hochgeschätzt.
Rituale Allerdings standen Juden immer vor dem Problem, wie sie Wein genießen konnten: stand er doch stets im Verdacht, für heidnische oder christliche Rituale verwendet zu werden. Zudem stellte sich die Frage, wie stark der Wein überhaupt sein durfte. Diesem Thema und seinen halachischen Konsequenzen hat der Hamburger Judaist Giuseppe Veltri mit Blick auf die späte Antike scharfsinnige Überlegungen gewidmet.
Im Mittelalter dann zeigte sich, dass die begeisternde Kraft des Weines zu einem Aberglauben eigener Art führte: Bill Rebiger aus Berlin weist ebenso wie Else Morlok nach, dass sich um den Wein auch und gerade im Judentum magische Praktiken rankten und dass Kabbala und Chassidismus sich dieser Kräfte in besonderer Weise zu bedienen wussten. Dass Wein seinen eigenen Ort in den zehn Sefirot der Kabbala hatte, wie sie im Zohar entfaltet wird, ist dabei eine neue, überraschende Erkenntnis.
Bei alledem waren Juden damals genusssüchtige, trinkfreudige Menschen wie andere auch. So zeigt der Herausgeber des Bandes, Andreas Lenhardt, dass Juden im Mittelalter ausgesprochen weltliche Trinklieder sangen, etwa ein Lied, das vom Wettkampf zwischen Wasser und Wein handelt: »Preis sollstu mir lossen/sprach sich der Wein asu geil/auf dos Mizbeah (Altar) werd ich gegossen/alle Tag zwei Vierteil/Man kauft mich teuer um das Geld/man schließt mich in die guten Gezelt/so gießt man dich nieder auf das Feld.«
Ernüchterung Das Zeitalter der Aufklärung war demgegenüber zunächst nüchterner: In einer präzisen Fallstudie zeigt die Judaistin Uta Lohmann, wie einer der jüdischen Schüler Kants, David Friedländer, im späten 18. Jahrhundert den Versuch unternahm, einem zeitgenössisch aufgeklärten Publikum talmudische Weisheit mit Bezug auf den Genuss von Wein nahezubringen. Friedländers Vorbild Immanuel Kant war – obwohl mit vielen jüdischen Männern befreundet – mit Blick auf den jüdischen Glauben ein Antijudaist, mit Blick auf jüdische Händler ein Antisemit.
Gleichwohl berichtete der jüdische Arzt Marcus Herz, dass Kant ihm das Weintrinken beigebracht habe: »ein Getränke, das ich in der Tat bis dahin kaum der Erfahrung nach kannte, denn meine ganze körperliche Erziehung war eine ärmliche, von Wein war nie die Rede«.
Ambivalenz Man sieht: Wein und Judentum, das ist eine stets spannungsreiche Beziehung, die Juden in ihrer Furcht vor dem Rausch und ihrer Sehnsucht nach Begeisterung ein hohes Maß an Ambivalenztoleranz abverlangte und abverlangt.
Der vorzügliche Band ist in der neuen, von Joachim Schlör herausgegebenen Reihe »Jüdische Kulturgeschichte in der Moderne« erschienen – in dem noch jungen Neofelis Verlag.
Andreas Lehnhardt (Hrsg.): Wein und Judentum, Neofelis, Berlin 2014, 256 S., 29 €