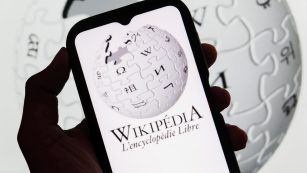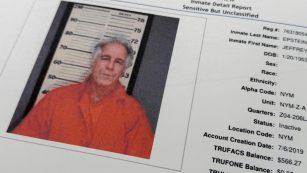Herr Mansour, wie wurden Sie zum Antisemiten und Islamisten?
Wie viele andere junge Männer wurde ich gewissermaßen dazu verführt. Ich bin in einem arabischen Dorf nahe Tel Aviv aufgewachsen. Dort war unser örtlicher Imam ein hoch angesehener Mann und Lehrer an meiner Schule. Als ich 13 Jahre alt war, sprach er mich plötzlich an und interessierte sich für mich. Er sagte mir, dass in mir das Potenzial zu Größerem stecke. »Der Islam braucht dich, mein Sohn!«, verkündete er, und dass ich ein guter Junge sei.
Sie fühlten sich geschmeichelt.
Absolut. Ich war perplex und geehrt. Bis dahin war ich ein sehr schüchterner Junge und fand nur schwer Freunde. Auf einmal war ich einer der Auserkorenen und Teil von etwas Großem. Bevor mich der Imam ansprach, endete meine Welt am Rande unseres Dorfes. Durch ihn lernte ich auch andere Städte kennen, als wir gemeinsam außerhalb islamistische Veranstaltungen besuchten. Das machte Eindruck auf mich.
Waren Ihre Eltern damit einverstanden, dass Sie plötzlich mit den Muslimbrüdern verkehrten?
Die waren zu der Zeit eher antireligiös eingestellt und insofern nicht allzu begeistert. Aber es war ihnen lieber, als wenn ich mich wie andere Jungen im Dorf einer Jugendgang angeschlossen hätte. Vielleicht waren sie auch ein bisschen stolz darauf, dass der Imam ausgerechnet mir sein Vertrauen schenkte.
Wie ging es dann weiter?
Der Imam lud mich zum Besuch seines Koranunterrichts ein. Ich folgte dieser verheißungsvollen Einladung nur zu gern. Der Unterricht fand in den kühlen Kellerräumen der Moschee statt, in denen wir uns jeden Donnerstag nach dem Abendgebet versammelten. Ich genoss die Kühle dort während der heißen Tage im israelischen Sommer. Irgendwie war es gemütlich mit all den Teppichen und gerahmten Suren. An diese ersten Stunden erinnere ich mich noch heute sehr gern. Es war faszinierend.
Weshalb?
Mir taten sich in der Koranschule neue Welten auf. Meine neuen gleichaltrigen Freunde und ich waren fasziniert von den sinnlichen Schilderungen des Paradieses. Wir folgten aufmerksam den Schilderungen des Imams über die Gärten der Wonne, die frischen Quellen und viele andere Annehmlichkeiten. Als ich hörte, dass ich zu einem Volk zählte, das einmal groß und mächtig war, löste das in mir natürlich Hochgefühle aus.
Doch irgendwann änderte sich die der Charakter des Islamunterrichts?
Von einem bestimmten Punkt an ging es nicht mehr um poetische Suren, sondern um islamistische Propaganda. Der Imam bezeichnete es als heilige Pflicht, dass Muslime für die Befreiung Palästinas kämpfen müssen. Er sprach vom Fluch, der auf den Juden laste, und vom Ziel der Islamisierung Europas. Und erst das Thema Frauen: Unverschleierte seien das personifizierte Böse und der Hölle geweiht.
Wodurch haben Sie sich schließlich von den Verführungen des religiösen Fundamentalismus abgewendet?
Die Lossagung war ein langer Prozess. Nach und nach entdeckte ich die Doppelmoral und die Heuchelei des Imams und seiner Gefolgsleute. Im Koranunterricht referierte er zum Beispiel immer über Gerechtigkeit – ein guter Muslim müsse sich immer und zu jeder Zeit gerecht verhalten. Nach dem Tod seiner Eltern verweigerte er jedoch im Namen Allahs der eigenen Schwester ihr Erbe. Durch solche Beobachtungen stieg in mir Skepsis auf.
Sie entschlossen sich dann, in Tel Aviv Psychologie zu studieren. Welche Erfahrungen machten Sie dort?
Ich hatte an der Universität zum ersten Mal richtigen Kontakt mit Juden. Ich merkte rasch, dass meine jüdischen Kommilitonen Menschen wie du und ich sind. Mein Feindbild wurde durch die Realität ad absurdum geführt. Der Umzug nach Tel Aviv war für mich eine Art Erweckungserlebnis. Dort begann mein Weg zur Aufklärung und Demokratie.
Seit 2004 leben Sie in Berlin und arbeiten mit Jugendlichen aus der muslimischen Community. Hilft Ihnen dabei Ihre Biografie?
Ja, ich weiß, wovon ich rede und kenne die Lebenswelt der Jugendlichen. Das merken sie, wenn wir über Antisemitismus, Radikalisierung und über Gewalt in der Erziehung diskutieren. Alle drei Themen stellen in diesem Milieu nach wie vor ein Problem dar.
Ist der Antisemitismus unter muslimischen Migranten weiter verbreitet als in der Mehrheitsgesellschaft?
Statistisch gesehen ist er in muslimischen Communitys drei- bis viermal höher als bei »Biodeutschen«.
Woher kommt dieser Hass?
Es gibt mehrere Quellen. Weit verbreitet sind Verschwörungstheorien, wonach Juden beispielsweise für die Anschläge vom 11. September verantwortlich seien. Dann gibt es die arabisch-antizionistische Richtung. Für sie ist der Konflikt im Nahen Osten klar: Juden sind immer Täter, Muslime immer Opfer. Und dann gibt es auch noch diejenigen, die religiös argumentieren und dafür Geschichten aus dem Koran aus ihrem historischen und lokalen Kontext reißen und antisemitisch interpretieren. Immerhin beschäftigt sich rund ein Drittel des Korans mit Juden.
Wie begegnen Sie diesen Ressentiments?
Ich gebe Denkanstöße und zeige, dass die Realität komplexer ist als die bösen Juden auf der einen Seite und die armen Muslime auf der anderen. Darüber hinaus versuche ich immer, gewinnend zu arbeiten – und nicht auszugrenzen.
Mit welchem Ergebnis?
Meine Arbeit erfordert Zeit und Geduld. Es ist ein langer Weg zum kritischen Denken. Das Gros der muslimischen Jugendlichen in Deutschland kommt aus patriarchalischen Milieus, in denen Selbstdenken nicht erwünscht ist. Umso großartiger ist es, wenn dann im Gespräch bei jemandem der Groschen fällt, wie sich der Funke des Selbstdenkens entzündet. Das passiert häufiger, als viele islamophobe Menschen glauben.
Das Gespräch mit dem Psychologen führte Philipp Peyman Engel.
Ahmad Mansour wurde 1976 in Israel geboren. Seit 2004 lebt er als Diplom-Psychologe in Berlin. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Gesellschaft Demokratische Kultur, Gruppenleiter beim HEROES-Projekt in Berlin sowie Policy Advisor bei der Stiftung European Foundation for Democracy. Außerdem ist Ahmad Mansour Mitglied der Arbeitsgruppe »Präventionsarbeit mit Jugendlichen« der Deutschen Islamkonferenz.