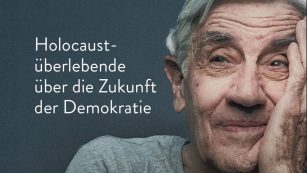Am 19. Juli 1950 wurde in Frankfurt am Main der Zentralrat der Juden in Deutschland gegründet - nur fünf Jahre nach dem Ende der Schoa. Mittlerweile sitzt er in Berlin, nahe der Neuen Synagoge an der Oranienburger Straße. Wie sich der Zentralrat in den 75 Jahren seines Bestehens verändert hat, erklärt Präsident Josef Schuster im Interview. Er spricht auch über Antisemitismus, Bildung, die Zukunft jüdischer Gemeinden - und seine eigene an der Spitze des Dachverbandes. Schuster ist auch Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde Würzburg und Unterfranken.
Herr Schuster, wie hat sich der Zentralrat in den 75 Jahren seines Bestehens verändert?
Josef Schuster: Bei seiner Gründung nur fünf Jahre nach der Schoa wollten die Gründungsväter den noch in Deutschland lebenden Juden behilflich sein, insbesondere bei der Auswanderung, sei es nach Israel oder in die USA. Hier hat es natürlich einen grundlegenden Wandel gegeben. Heute ist der Zentralrat die politische, religiöse und gesellschaftliche Vertretung der Interessen der Jüdinnen und Juden in Deutschland.
An welche Ereignisse denken Sie besonders, wenn Sie die 75 Jahre Revue passieren lassen?
Eine ganz entscheidende Wegmarke war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da begann der Prozess, dass Juden dazu standen, bewusst in Deutschland zu leben. Das hatte sich unter dem damaligen Präsidenten Werner Nachmann gewandelt: Man konnte, ohne rot im Gesicht zu werden, sagen: Ja, ich lebe bewusst in Deutschland.
In den 1990er Jahren dann wuchsen die jüdischen Gemeinden durch den Zuzug von Menschen aus der Ex-Sowjetunion.
Das hatte einen doppelten Effekt. Einerseits sollten die »Kontingentflüchtlinge« vor Antisemitismus in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion geschützt werden. Andererseits stiegen die Mitgliederzahlen in den jüdischen Gemeinden an. 1990 hatten wir knapp 28.000 Mitglieder bundesweit. Heute sind es 105 Gemeinden unter dem Zentralratsdach mit etwa 100.000 Mitgliedern - ein stabiles, gesundes jüdisches Leben.
Welche Entwicklungen sehen Sie noch?
Meilensteine in der Arbeit des Zentralrats waren in den vergangenen Jahren die Einrichtung eines Militärrabbinats bei der Bundeswehr vor etwa fünf Jahren und die Gründung der Jüdischen Akademie in Frankfurt, die 2024 Richtfest gefeiert hat und die 2026 eröffnet werden soll. Wichtig war auch der Staatsvertrag 2003, der die Zuwendungen des Bundes an den Zentralrat regelt. Mittlerweile gibt es auch Staatsverträge auf Landesebene.
Heute ist der Zentralrat eine Interessenvertretung …
Ja, nach innen und außen. Nach außen ist sie gerade leider aktueller denn je. Dazu gehört - auch wenn ich das nicht primär als Aufgabe von Juden sehe - der Kampf gegen Antisemitismus und gegen die Feinde der Demokratie. Der Zentralrat vertritt die Interessen der jüdischen Gemeinschaft gegenüber der Bundesregierung, die Landesverbände haben ihr Gegenüber in den Landesregierungen.
Und die Arbeit nach innen?
Da geht es um die Stärkung der Gemeinden. Wir haben Programme wie das Gemeindecoaching, so dass die Arbeit vor Ort noch professioneller gemacht werden kann. Es geht um Gemeinschaftsbildung durch Veranstaltungen wie die jährliche Jewrovision für Kinder und Jugendliche oder den alle drei Jahre stattfindenden Gemeindetag. Die Ausübung der Religion muss sichergestellt werden, wobei an die verschiedenen Denominationen, also die Richtungen im Judentum, gedacht werden muss. Deshalb gibt es unter dem Dach des Zentralrats auch zwei Rabbinerkonferenzen: die Orthodoxe Rabbinerkonferenz und die Allgemeine Rabbinerkonferenz.
Vor welcher Entwicklung stehen die jüdischen Gemeinden?
Es fehlt an engagiertem Nachwuchs, womöglich wird es zu Zusammenschlüssen von Gemeinden kommen. Solche Zusammenlegungen sind schmerzlich. Die Situation ist aber eine andere als in der katholischen Kirche, in der es zu wenig neue Priester gibt. Bei Rabbinern sieht es besser aus.
Es gab Kritik am Zentralrat, dass er nicht alle Richtungen des Judentums gleichrangig vertreten würde.
Diese Kritik entbehrt jeder Grundlage. Der Zentralrat fördert eine liberale Rabbinerausbildung in Potsdam. Unter unserem Dach gibt es die liberale Rabbinerkonferenz und mit dem Jüdischen Liberal-Egalitären Verband (JLEV) auch einen Zusammenschluss liberaler Gemeinden und Gruppen, die sich auch innerhalb einer Einheitsgemeinde entfalten können. Eine Einheitsgemeinde folgt nicht von Grund auf einer bestimmten Denomination. Seit dem Ende der Schoa sind die Gemeinden aber insgesamt eher traditionell ausgerichtet, doch das ist ihre eigene Entscheidung, die sich an den Neigungen ihrer Mitglieder ausrichtet.
Ich selbst komme aus einer traditionellen Gemeinde, aber immer, wenn meine Eltern mit mir nach Israel gefahren sind, sind wir in einen liberalen Gottesdienst gegangen. Ich bin also mit beiden Denominationen groß geworden. Ich kann nicht erkennen, welchen Sinn eine Art Konkurrenzkampf haben sollte.
Sie sprachen bereits den Kampf gegen Antisemitismus an. Die Vorfälle und Straftaten sind seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Gazakrieg massiv gestiegen. Wie hat dies die Arbeit des Zentralrats verändert?
Wir sehen, dass sich antisemitische Vorfälle bis in die Mitte der Gesellschaft ziehen. Hier müssen wir aktiver werden: aufklären und Institutionen in ihrer Arbeit unterstützen. Bildung, auch schon bei Kindern, ist ganz entscheidend gegen Antisemitismus.
Zuletzt gab es Auseinandersetzungen über unterschiedliche Definitionen von Antisemitismus, vor allem zum israelbezogenen.
Darüber, was Antisemitismus ist, gibt es große Einigkeit. Diskussionen über vermeintliche Definitionen lenken vom eigentlichen Thema des steigenden Antisemitismus, vor allem des israelbezogenen Antisemitismus, in der Gesellschaft ab. Gerade dieser Antisemitismus ist es, den wir seit dem 7. Oktober 2023 leider sehr, sehr deutlich beobachten.
Mit welchen Themen wird sich der Zentralrat künftig beschäftigen müssen?
Der Kampf gegen Antisemitismus und für Demokratie bleibt. Da sehe ich dunkle Wolken am Himmel. Darüber hinaus müssen die Gemeinden vor allem vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung gestärkt werden.
Mit Ihnen als Präsident des Zentralrats?
Meine Amtszeit geht bis November 2026. Bis dahin bin ich hoch motiviert. Was nach November 2026 kommt: mal schauen. Wie heißt es so schön in Bayern? Schau ma mal, dann seng ma scho.
Das Gespräch mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland führte Leticia Witte.