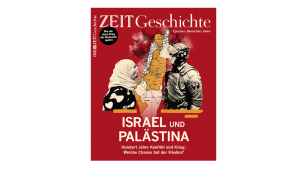Berlin war für mich immer ein Symbol für Vielfalt und Weltoffenheit. Auch jüdisches Leben war hier sichtbar, wirkte lebendig. Und Israel war präsenter als in anderen Teilen Deutschlands. Viele Israelis hatten Berlin zu ihrer zweiten Heimat gemacht und prägten zahlreiche Stadtbezirke.
Ich erinnere mich noch gut, wie ich zum ersten Mal am Berliner Hauptbahnhof aus dem Zug stieg. Ich war 18, kam aus der Provinz und dachte: »Eines Tages werde ich diese Stadt mein Zuhause nennen.« Ich wollte hierbleiben, Wurzeln schlagen. Zehn Jahre lang lebte ich in Berlin und stellte meine Entscheidung nie in Frage.
Am 7. Oktober 2023 änderte sich alles. Heute fällt es mir schwer, das zu sagen, aber ich fürchte, Berlin wird sich nie mehr so anfühlen wie früher.
Schon am 7. Oktober 2023, zu einem Zeitpunkt, als noch gar nicht klar war, wie viele unschuldige Menschen in Israel den bestialischen Massakern der Hamas zum Opfer gefallen waren, begannen in einigen Berliner Vierteln Kundgebungen, auf denen der Terrorangriff als Akt des Freiheitskampfes gefeiert wurde. Als die Häuser in den Kibbuzim noch brannten, wurden in Berlin Süßigkeiten verteilt. Es wurde »Tod den Zionisten« und »Tod Israel« gerufen.
In Neukölln saßen Menschen in den Cafés und jubelten über die Taten der Hamas, die schnell auf Videos verbreitet wurden. Es war der Beginn einer neuen, aggressiven Form des israelbezogenen Antisemitismus, der in Berlin bis heute in unverminderter Stärke anhält.
In den letzten Monaten habe ich Demonstrationszüge am Alexanderplatz, in Charlottenburg, in Mitte, in Wedding und in Neukölln begleitet. Jedes Mal, wenn ich mich diesen sogenannten pro-palästinensischen Kundgebungen nähere, zieht sich etwas in mir zusammen. Instinktiv verberge ich meinen Davidstern unter meiner Jacke. Es ist eine Geste, die mittlerweile reflexartig geworden ist.
Ich tue das nicht aus Scham, sondern aus Selbstschutz. Es ist nicht nur die Aggression in den Stimmen der Demonstranten, die mich bang werden lässt. Es ist auch das Gefühl einer existenziellen Bedrohung. Offener Hass bricht sich unter den rot-schwarz-weiß-grünen Fahnen Bahn. Er richtet sich nicht nur gegen den Staat Israel, sondern gegen alles, für das dieser Staat steht. Er richtet sich gegen jeden, der sich mit Israel irgendwie verbunden fühlt.
Irritierende Kundgebungen des Hasses
Diese Demonstrationen sind keine politische Kritik, sie sind kein Ruf nach Gerechtigkeit. Es geht nur vordergründig um das Leid der Menschen in Gaza oder die Eigenstaatlichkeit Palästinas. Nein, es geht um Vernichtung: die Vernichtung des jüdischen Staates und in letzter Konsequenz jeglicher Präsenz jüdischer Menschen dort.
Der Begriff »Terror« fällt ausschließlich in Bezug auf das, was die Demonstranten als »terroristisches zionistisches Regime« bezeichnen. Die Hamas wird nicht verurteilt, im Gegenteil: Sie wird als legitimer Widerstand glorifiziert. Die meisten Reden finden auf Arabisch statt, oft ohne Übersetzung. Frauen und Kinder halten Puppen hoch, die mit Kunstblut übergossen sind. Sie rufen Parolen wie »Intifada« und »Widerstand«.
Wer sich dem widersetzt, wird als »Kindermörder« beschimpft oder als Teil der »Lügenpresse« diffamiert, welche angeblich von zionistischen Weltmächten gesteuert wird. Man brüllt, kreischt, rauft sich die Haare, beleidigt, droht. Es ist ein andauernder, aggressiver Ruf nach Gewalt, der zunehmend nicht nur skurril, sondern gefährlich ist.
Gleichzeitig richtet sich der Hass immer häufiger auch gegen Deutschland, gegen unsere demokratische Ordnung, gegen die Polizei. »Fuck Germany« ist hier ein absolut gängiger Ausruf. Umso irritierender ist es, wenn Medien wie die »taz« den Nakba-Tag, an dem ein Berliner Polizist schwer verletzt wurde und der zu einem Aufgebot von tausenden Einsatzkräften führte, als »Gedenkkundgebung« bezeichnen oder als »Palästina solidarisch«. Die Etikettierung als »pro-palästinensisch« verschleiert, was diese Proteste oft tatsächlich sind: antisemitische Hassveranstaltungen.
Auffällig ist auch, wie still es bleibt, wenn islamistische Gruppierungen bei diesen Demonstrationen Seite an Seite mit Teilen der radikalen Linken marschieren. Es ist eine unheilige Allianz, die öffentlich kaum thematisiert wird. Wie groß wäre zu Recht der Aufschrei, wenn es sich stattdessen um rechtsradikale Gruppen handelte. Wenn es aber um islamistische Strömungen geht, bleiben Politik und Gesellschaft oft still. Sei es aus Naivität, Ignoranz oder aus Angst, als rassistisch zu gelten.
Karoline Preisler wird bedroht – für die Verteidigung elementarer Werte
Der Hass trifft hier in Berlin aber vor allem auch Karoline Preisler. Die FDP-Politikerin und Aktivistin steht seit dem 7. Oktober mit einem klaren Satz in der Öffentlichkeit: »Rape is not resistance.« Es ist eine sehr klare, einfache Botschaft, die eigentlich in einer offenen Gesellschaft auf breite Zustimmung stoßen müsste. Es ist ein Satz, der nichts anderes besagt als das Offensichtliche. Doch auf diesen Demonstrationen wird Preisler als Provokateurin bezeichnet, sie wird zum Feindbild erklärt.
Dabei steht Karoline Preisler für etwas, das längst aus der Mode gekommen scheint: moralische Klarheit. Ihre Präsenz auf der Straße ist unbequem, weil sie den moralischen Nullpunkt offenlegt, an dem sexualisierte Gewalt plötzlich als politische Waffe verharmlost, gerechtfertigt oder geleugnet wird. Sie verkörpert einen Feminismus, der nicht opportunistisch, nicht selektiv ist und der sich nicht im akademischen Diskurs erschöpft.
Sie stellt unbequeme Fragen an all jene, die sich sonst lautstark für Frauenrechte einsetzen, hier aber schweigen. Preisler zeigt, was Zivilcourage heute wirklich bedeutet: Auch dann klare Haltung zu zeigen, wenn sie Widerstand provoziert.
Ich habe sie mehrfach auf Demonstrationen begleitet. Was mir dabei begegnete, war ein tiefsitzender, fast fanatischer Zorn. Preisler wird beschimpft, bedroht, verspottet – für die Verteidigung elementarer Werte. Dass sie dennoch immer wieder hingeht und ruhig bleibt, dass sie Präsenz zeigt, ist kein Zeichen von Trotz, sondern von Haltung. Sie tut es - wie sie selbst sagt – nicht nur für die Geiseln in Israel, sondern für die Zukunft ihrer Kinder. Für ein demokratisches Deutschland, das diesen Namen verdient.
Fehlverhalten hat kaum Konsequenzen
Was sich auf Berliner Straßen abspielt, hat längst die Grenzen politischer Meinungsäußerung überschritten. Es hat nicht nur das gesellschaftliche Klima, sondern auch meine Beziehung zu dieser Stadt getrübt. Berlin ist nicht mehr der Ort, der einem ein Gefühl der Sicherheit und das Vertrauen in eine offene, tolerante Gesellschaft gibt. In Berlin fühlt man sich heutzutage fremd, schutzlos und bedroht.
Und das nicht nur wegen der Demonstrationen, sondern wegen des ständigen Wegsehens der Verantwortlichen, wegen des Schweigens der Politik, der Ineffizienz der Justiz, der Passivität der Zivilgesellschaft.
Ja, es gibt vereinzelt Mahnungen, es gibt Besorgnis. Aber viel zu selten folgen daraus Konsequenzen. Heute frage ich mich: Kann Berlin jemals wieder ein Ort sein, an dem jüdische und israelische Menschen sich zu Hause fühlen können? Gibt es noch Platz für sie in dieser Stadt?
Ich hoffe, dass es in Berlin noch mehr Menschen wie Karoline Preisler gibt, die den Mut haben, sich dem Irrsinn in den Weg zu stellen. Doch vor allem hoffe ich, dass die Politik und Justiz endlich aufwachen und verstehen: Demonstrationen mit antisemitischem, gewaltverherrlichendem oder staatsfeindlichem Charakter dürfen nicht toleriert werden.
Sie sind keine legitime Meinungsäußerung. Sie sind gefährlich – für unsere Gesellschaft, unsere Sicherheit, unsere Demokratie.