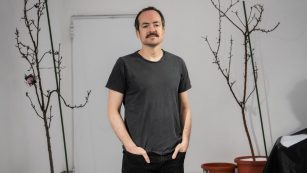Sigalit Landau (54) gilt als eine der bedeutendsten zeitgenössischen Künstlerinnen Israels. Ein wichtiges Laboratorium ihrer Arbeit ist das Tote Meer, der salzigste Ort der Welt. Über Wochen und Monate taucht sie Gegenstände in das Meer, bis diese von Salz überzogen sind.
Neben politischen und ökologischen Fragen, die das einzigartige Gewässer aufwühlt, gehören christliche Referenzen zu Landaus vielschichtiger Arbeit, sagt Amitai Mendelsohn. Als Kurator ist er verantwortlich für die jüngste Ausstellung zu Landaus Werk »Das brennende Meer«, die noch bis Mitte Juni im Israel Museum in Jerusalem zu sehen ist.
Landschaft Historisch, politisch und religiös aufgeladen ist die Landschaft, in der Sigalit Landau seit mehr als zwei Jahrzehnten ihre Salzkunstwerke schafft. Viele Geschichten der Bibel trugen sich hier zu. Hier wurden die berühmten Schriftrollen von Qumran gefunden. Hier treffen auch die Grenzen Israels, Jordaniens und eines künftigen Staates Palästina aufeinander. Und hier spielt sich eines der großen Umweltdramen der Region ab. Seit Jahrzehnten sinkt der Pegel des Salzmeeres am tiefsten begehbaren Punkt der Erde, das vom Austrocknen bedroht ist.
In der Ausstellung geht es um Kontraste, sagt Amitai Mendelsohn, um die Dualität von Leben und Tod, Verletzung und Heilung, Zerstörung und Hoffnung. In ihr sieht der Ausstellungsverantwortliche, der über die Figur Jesus in jüdischer und israelischer Kunst promoviert hat, eine treibende Kraft hinter den Arbeiten der jüdischen Künstlerin. Auch sie, so Mendelsohn, habe eine spannende Beziehung zur Figur Jesus.
Wassermelonen Es ist die zweite Ausstellung, die das Museum Landau widmet. 1995 hatte sie, als eine der jüngsten Künstlerinnen überhaupt, ihre erste Einzelausstellung dort. Zur Ikone geworden ist ihr Video »Totes Meer« (2005), das in der aktuellen Ausstellung zu sehen ist. 500 Wassermelonen, wie aufgereihte Perlen, treiben als Spirale im Toten Meer. Inmitten der Melonen: die Künstlerin selbst, nackt.
Für Kurator Mendelsohn ist das Video wie Landaus Kunst voller Metaphern: »Die Süße der Wassermelonen trifft das Salz des Meeres, ein Kampf zwischen Leben und Tod. 17 der Wassermelonen sind verletzt. Ihr rotes Fruchtfleisch leuchtet inmitten von Grün. Landau ist Nummer 18 - der Zahlenwert des hebräischen Wortes «chai» - Leben«.
Ritualbad Rituell-religiöse Elemente sind für den Kurator zentral für die Arbeiten Landaus. Der nackte Körper im Wasser etwa, wie in der Videoinstallation, berge Anspielungen an Reinigung, das jüdische Ritualbad (Mikwe) oder auch die christliche Taufe, an die ein mit Salz überzogenes Taufbecken am Eingang der Ausstellung erinnert.
Unterwasserfotografien von Gegenständen im Kristallisationsprozess gehören ebenso wie die salzüberzogenen Endergebnisse zur Ausstellung. Gräulich-weiß und schimmernd, offenbaren sie dem Betrachter erst auf den zweiten Blick ihre ursprüngliche Gestalt. Da sind die Fischernetze aus der Hafenstadt Jaffa, Krankentragen, Kleidungsstücke wie ein Ballett-Tutu, das, salzerstarrt, von selbst im Raum zu stehen scheint. Oder lampenschirmähnliche Skulpturen aus Stacheldraht, auch sie über und über mit Salz überzogen.
Dornenkrone In der Kunst verliert der Stacheldraht, sinnbildlich für den anhaltenden Konflikt, das Gefährliche und Trennende, sagt die Künstlerin in einem Interview - und erinnert an die Dornenkrone Jesu bei seiner Hinrichtung.
Mendelsohn sieht auch hier die Dualität. Dem Symbol für Macht und Schönheit seien Schmerz, Beleidigung und Wunden gegenübergestellt. Als Bild des Letzten Abendmahls lasse sich die Installation »Wassermelonentisch« (2007) lesen - zwölf Stücke Wassermelone, konserviert in einem Salzbett.
Zusammenkunft Die Ausstellung endet mit Landaus größter Vision für das Tote Meer: einer Brücke über das Tote Meer zwischen Israel und Jordanien. Die »Verbindung zwischen Himmel, Meer und Land« charakterisiere die Region, sagt die Künstlerin. Das Meer sei dabei ein Ort der Zusammenkunft. Die Umwelttragödie dort könne »zu einer einzigartigen Chance werden, unser gemeinsames Schicksal auf konkrete Weise zu verwirklichen«.
Eine Brücke würde zum Zeichen der Erkenntnis gegenseitiger Abhängigkeit und gleichzeitig zur Einladung, Vertrauen zu schaffen. An dem historischen Tag, an dem der Damm am Süd-Ende des See Genezareth geöffnet und der Jordanfluss wieder in das Tote Meer fließen werde, sagt Landau, »werden sowohl die Geografie als auch die Biografie dieser Region geheilt werden. Andere Arten der Rettung werden folgen, und das Meer wird nicht mehr brennen.«