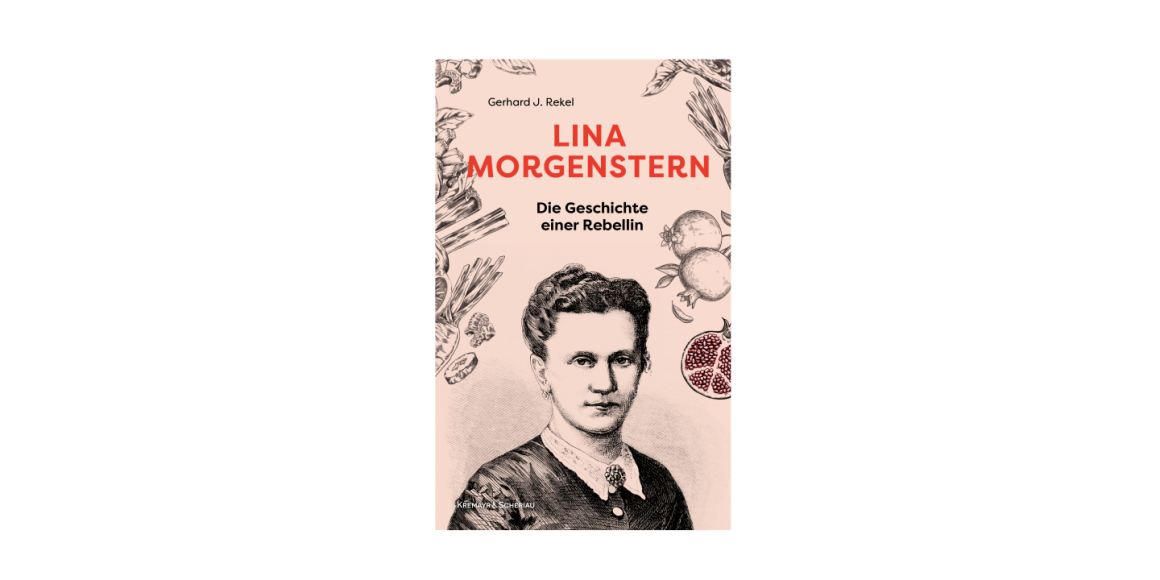Dem Eröffnungskapitel, das im Sommer 1870 spielt, schickt der Autor ein Zitat der polnisch-französischen Physikerin Marie Curie voraus: »Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss.« Treffender kann man die Motivation der deutsch-jüdischen Schriftstellerin, Frauenrechtlerin und Sozialaktivistin Lina Morgenstern nicht beschreiben.
Dabei ist die Gründung und Unterstützung der Fröbelʼschen Kindergartenbewegung nur eines ihrer ehrgeizigen Projekte. Von ihrem Biografen Gerhard J. Rekel erfährt die Leserschaft, dass Lina Morgenstern »klein, rundlich, lustig, voller Energie, spontan, weltoffen und in manchen Bereichen chaotisch« gewesen sei. Eigenschaften, die bei Frauen im männerdominierten 19. Jahrhundert nicht immer als vorteilhaft empfunden wurden.
Unkonventionelle Ehe
Lina Morgenstern führte mit ihrem Ehemann Theodor eine eher unkonventionelle Ehe (»deren Geheimnis sich die beiden bis zum Schluss bewahrten«), zog liebevoll fünf Kinder groß, bevorzugte gutes Essen. Manchmal vergaß die energiegeladene Aktivistin zu schlafen. So kümmerte sich Lina Morgenstern fast rund um die Uhr um die Volksküchen, den Kinderschutzverein und die Fortbildungsschulen für junge Frauen und in diesem Kriegssommer zudem um die Versorgung der preußischen Soldaten mit Speis und Trank.
Die Gründung und Unterstützung der Fröbelʼschen Kindergartenbewegung war nur eines ihrer ehrgeizigen Projekte.
Morgensterns Geschichte beginnt in Breslau, wo sie im November 1830 geboren wird und eine traditionelle jüdische Kindheit verlebt. Sie besucht die »Synagoge zum Weißen Storch« und wird von ihrem Religionslehrer Abraham Geiger »zum selbstständigen Nachdenken über ethische Bestimmungen ermutigt«. Geistige Anregungen findet sie in der Lektüre der Briefe von Rahel Varnhagen und den Traktaten der Bettina von Arnim. Bald schreibt sie auch eigene Geschichten auf. Später wird Lina Morgenstern, nach dem wirtschaftlichen Bankrott ihres Gatten als Modehändler, die Familie als Kinderbuchautorin durchbringen.
Daneben interessiert sie sich bereits seit den 1850er-Jahren für die Publikationen der Pädagogen Friedrich Fröbel und Johann Heinrich Pestalozzi. Davon inspiriert unternimmt sie den Versuch, einen ersten Kindergarten zu gründen. In Preußen war das damals eine politische Provokation, hatte doch der konservative Kultusminister Karl Otto von Raumer derartige Bestrebungen amtlicherseits verboten.
Dem Fröbelʼschen Ideal, das dieser Bewegung zugrunde lag, wurde unterstellt, »atheistisch und demagogisch« zu sein. Lina hält dagegen – und das letztlich mit Erfolg. Sie initiiert auch zahlreiche Organisationen für Frauen in Notlagen und bringt die erste Zeitung ausschließlich für Frauen heraus.
Situative Bilder, teils fiktive Locations und Reportagestil
Gerhard J. Rekel schreibt Drehbücher für das deutsche Fernsehen und verfasste bereits mehrere Romane. Nun also die »Geschichte einer Rebellin«, wie seine Morgenstern-Biografie im Untertitel heißt. Der Autor entwirft situative Bilder und verfällt gelegentlich in einen durchaus lesenswerten Reportagestil.
Um Bildhaftigkeit bemüht, kreiert er Locations, die notgedrungen teils einen fiktiven Charakter haben müssen. Nicht fiktiv hingegen – das beweisen nicht weniger als 745 Quellenangaben – sind die geschilderten Lebensdaten der Lina Morgenstern.
So entstand die Geschichte einer kämpferischen jüdischen Frau, die das durch Abraham Geiger angeregte selbstständige Denken optimal genutzt hat. Und dies zu einer Zeit, als es Frauen noch nicht zugestanden wurde.
Gerhard J. Rekel: »Lina Morgenstern. Die Geschichte einer Rebellin«. Kremayr & Scheriau, Wien 2025, 259 S., 26 €