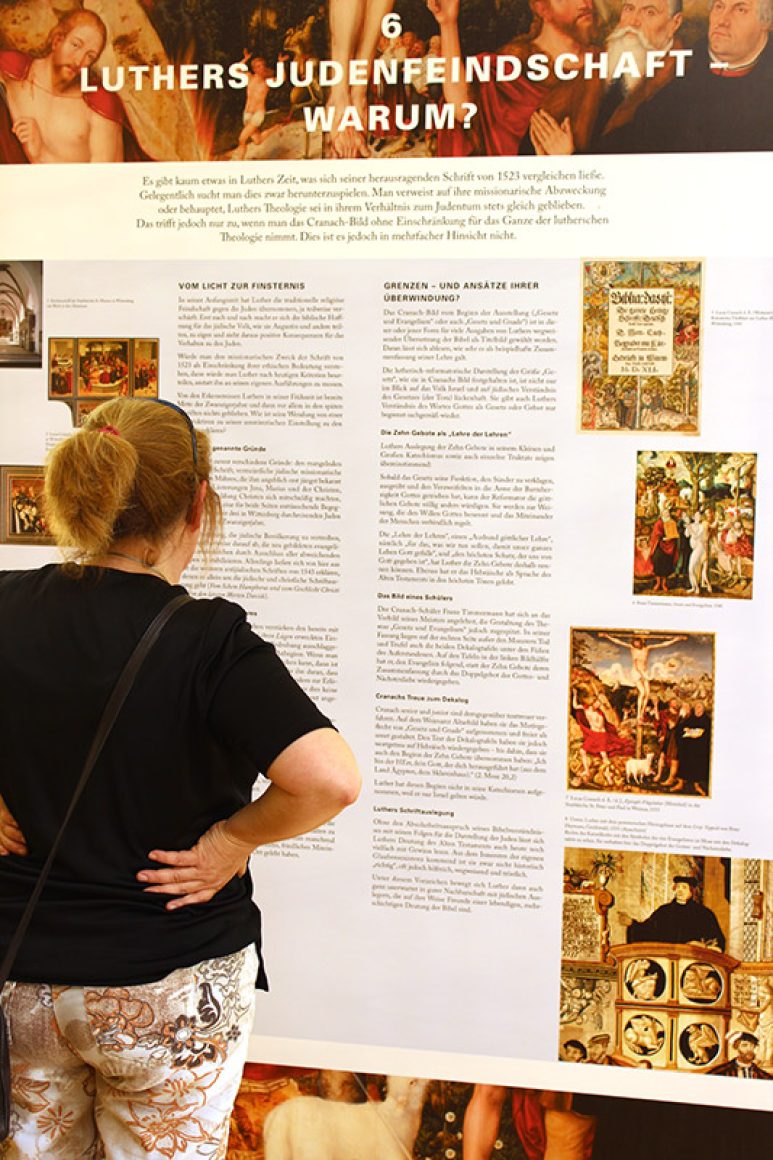Es ist ein ungewöhnlicher Ort für den Kirchentag: das Kultur- und Bildungszentrum der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen. Israelische Speisen duften, Gesprächsfetzen der Kirchentagsgäste sind zu hören. Wer hier ist, will mehr über den selbstkritischen Umgang mit Luthers antijüdischem Erbe erfahren.
»Sie haben es gemerkt«, sagt Reinhard Schramm, Vorsitzende der Landesgemeinde in Erfurt, zur Eröffnung der bemerkenswerten Ausstellung »Martin Luther und das Judentum«: »Die Gemeinde als solche freut sich.« Erstmals kommen Christen und Juden im Rahmen eines Kirchentages an diesem Ort und zu diesem Thema zusammen. Man will über die Narben des jüdisch-christlichen Miteinanders sprechen.
Wunden Sind es nur Narben? Gerhard Robbers, der die Gesamtleitung des Kirchentages innehatte, wird bei der Frage nach den »Narben« nachdenklich. Am Abend zuvor sagte er auf dem Erfurter Domplatz: »Für mich ist es eine offene Wunde. Sie schmerzt weiter. Und wir müssen sehen, wie wir mit ihr umgehen können.« »Luther«, sagt Reinhard Schramm, »der Name geht mir nicht so leicht über die Lippen.« Was er getan habe, war eben »nicht ganz koscher«.
Der inhaltliche Rahmen ist gesetzt, und es gilt zu klären, ob es bei Bekenntnissen der Kirche bleibt oder nicht. »Wie kommen wir zu einer wirklichen Geschwisterlichkeit?«, fragt eine Frau mittleren Alters in einem Workshop. »Es ist doch eher ein Gespräch unter Theologen. Bei vielen Menschen spüre ich kein Interesse.«
Margot Käßmann, Reformationsbotschafterin, formuliert die klare Haltung der Kirche heute: »Erinnern Sie sich an die 95 Thesen Luthers. Die erste These, die er geschrieben hat: Das ganze Leben soll Buße sein. Man soll sich immer wieder klar machen, dass man auch Fehler macht. Und dieses ›Buße tun‹, ich bin sicher, dass Luther, wenn er heute leben würde, wenn er diese Geschichte kennen würde, die daraus entstanden ist – er würde genau das tun, was er als seine erste These bezeichnet hat: nämlich Buße tun! Und das ist es, was wir tun müssen.«
Theologie Es sind aufwühlende Gespräche. Peter von der Osten-Sacken, der ehemalige Leiter des Instituts für Kirche und Judentum an der Humboldt-Universität Berlin, blickt auf den Reformator und seine Zeit: »Die jüdische, wörtliche Auslegung der Bibel gewann Anhänger. Luther sah darin einen Angriff auf die christliche und damit auch auf seine eigene Glaubensgewissheit. Luther ist nicht der Glaubensheld gewesen, der uns überliefert worden ist. Luther ist über viele Jahre ein zutiefst angefochtener Mensch gewesen. Das spricht nicht gegen ihn. Die Frage ist: Wie ging er damit um? Das ist das Problem!« – und damit vermutlich die Ursache seines kritischen Umgangs mit Juden.
»Luthers Schriften gegen die Juden hatten noch zu seinen Lebzeiten und bis ins späte 18. Jahrhundert hinein politische Auswirkungen. Im 19. Jahrhundert wurden sie von antisemitischen Kreisen aufgegriffen, die mit ihrer antijüdischen Propaganda kräftigen Widerhall unter Christen fanden, auch unter Theologen. Im 20. Jahrhundert wurden die Schriften nachgedruckt und zur Rechtfertigung der antisemitischen Kirchenpolitik benutzt.«
Beschönigung Es gibt nichts zu beschönigen. »Ich habe eine Nacht nicht geschlafen«, meldet sich eine Frau zu Wort. Sie sei vor Jahren aus Russland nach Deutschland gekommen und Christin geworden. Ihr Vater sei Chinese, Wurzeln der mütterlichen Familie lägen in der Mongolei. Ihr Großvater war Jude. Sie stockt und erzählt verzweifelt, wie es ihr oftmals ergangen sei, nirgendwo dazuzugehören, Ablehnung zu erfahren und immer wieder die Frage zu hören: Woher kommst du? Der Glaube gebe ihr Kraft oder, besser gesagt, gab ihr Kraft. Nach all dem, was sie nun über Luther höre, kommen ihr Zweifel. Es sind jene Momente, die auch die Referenten fast verstummen lassen, wenn Menschen mit schwäbischem, rheinischem oder russischem Akzent über ihre Erfahrungen in den unterschiedlichsten Kirchengemeinden in Ost und West erzählen. Alles koscher? Eher nicht!
Grundmann »Der Befund liegt vor und ist klar.« Tobias Schüfer, Studienleiter der Vikarsausbildung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, hält nichts von nebulösen Worten. Er stapelt Bücher auf einem Tisch, wissenschaftliche Schriften über das sogenannte Entjudungsinstitut (1939–1945) von Walter Grundmann in Eisenach. Ein Theologe, der im Sinne der Nationalsozialisten nicht nur Bibel und Gesangbuch »judenrein zu übersetzen« versuchte.
Nach 1945 war er wieder als Pfarrer in Thüringen tätig, übernahm sogar leitende Funktionen in der Ausbildung der Katecheten und spitzelte für die Staatssicherheit, wie heute die Akten belegen. Eines steht fest, so Tobias Schüfer, nach 1945 habe es keine kritische Distanz zu Walter Grundmann gegeben. Im Gegenteil. Er war ein Mann der Kirche, dem man Respekt und Achtung zollte – vor allem aber die Ausbildung einer neuen Generation anvertraute. »Für die Schoa findet Grundmann kaum Worte. Mit eigener Schuld oder der Arbeit des einstigen Instituts setzte er sich nicht auseinander.«
Erbe Wie also, fragen Wissenschaftler heute, gehen wir – die dritte Generation – mit diesem Erbe um? »Wir müssen die transgenerationelle Komplizenschaft aufkündigen.« Es rumort also weiter, und die Frage, die sich die Evangelische Kirche stellen muss, ist: Was machen wir mit den Ergebnissen, damit sich die Kirche von Luthers Antisemitismus distanziert?
In Thüringen gibt es den Arbeitskreis Kirche und Judentum. Es gibt Beiräte und Gesprächskreise für das Thema. Doch reicht das? Conrad Krannich, Theologe aus Halle (Saale), formuliert es »trotzig und persönlich«: Er wünsche sich mehr! Auch für ihn steht das Ringen um den richtigen Weg der Kirche gerade erst am Anfang.
»Es berührt mich, was hier passiert ist in anderthalb Tagen. Gerade hier im jüdischen Zentrum, in diesen Räumen.« Es liege an den Menschen, an jedem einzelnen. In einem Workshop, den er mit Tobias Schüfer leitet, liegen Karten mit der Aufforderung, die eigenen Positionen zu formulieren, auf den Tischen: »Hier stehe ich im christlich-jüdischen Dialog …« und »Das will ich anders …«.
Im Laufe des Kirchentages wird viel darüber diskutiert, gerungen und geschrieben. Krannich fordert: »Mehr von dieser Selbstverständlichkeit.« Und: »Dass diese Frage den jungen Menschen in unserer Kirche – auch während ihrer Ausbildung – gestellt wird.« Was ist mit den antijüdischen Versatzstücken in der Theologie heute?
Es geht nicht mehr um das: »Hier stehen wir und wollen anders!«, sondern um das: »Hier stehen wir und können anders!« »Christus war nicht Jude, er ist Jude. Auch das muss zum Herzensbekenntnis gehören.« Diese Klarheit würde schon helfen, stellt Pfarrer Ricklef Münnich, einer der Organisatoren des Dialogs, fest.