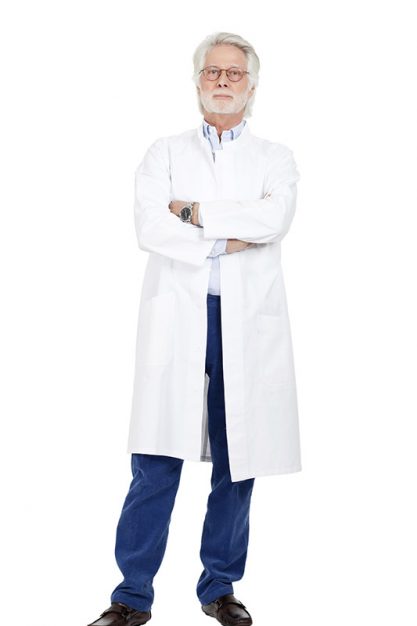Soll ein Psychiater den Arbeitgeber eines Patienten, der selbstmordgefährdet ist, informieren? Soll ein Allgemeinarzt die Ehefrau eines Patienten benachrichtigen, in dessen Blut der HI-Virus nachgewiesen werden konnte – weil der Frau sonst droht, ebenfalls infiziert zu werden? Oder wäre dies ein Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht?
Derzeit wird viel über eine mögliche Lockerung der Schweigepflicht diskutiert, nachdem der Kopilot, der laut Staatsanwaltschaft psychisch krank war, die Maschine des Germanwings-Fluges 4U9525 absichtlich – so die Ermittler – abstürzen ließ. Für uns ist es wichtig, diese Frage nicht nur unter allgemeinen rechtlichen Aspekten zu diskutieren, sondern auch die halachischen Hintergründe zu beleuchten.
Von bestimmten Fachleuten erwarten wir, dass sie unsere Geheimnisse mit ins Grab nehmen. Ärzte, Anwälte, Steuerberater, Regierungsbeamte, Geistliche und viele andere Berufsgruppen unterstehen einer Schweigepflicht oder einem Zeugnisverweigerungsrecht. Der Ursprung dieser Schweigepflicht liegt einerseits im hippokratischen Eid und andererseits im Beichtgeheimnis. Je nach Rechtsprechung ist von einer Schweigepflicht oder einem Recht auf Schweigen (oder einer Kombination von beidem) die Rede. Die genauen Umstände werden entweder durch Berufsverbände oder das geltende Gesetz definiert.
In Deutschland ist die Schweigepflicht in der Verfassung verankert, und auch die Schweigepflicht der unterschiedlichen Berufe wird vom Gesetz bestimmt – hauptsächlich in Paragraf 203 des Strafgesetzbuches (StGB). Begründet wird die Schweigepflicht zum einen mit dem grundsätzlichen Recht auf Schutz der Privatsphäre, zum anderen leitet sie sich aus den Pflichten des schweigepflichtigen Beraters seinem Auftraggeber gegenüber ab.
Depressionen Ein Patient, der Depressionen hat, muss davon ausgehen können, dass sein Psychiater dem Arbeitgeber keine Auskunft über seine Beschwerden oder eventuell sogar über Selbstmordversuche erteilt. Sonst würden Patienten davor zurückschrecken, offen über ihre Probleme zu sprechen – oder sich gar nicht in ärztliche Behandlung begeben, obwohl diese notwendig ist. Ohne behandelnden Arzt steigt jedoch die Gefahr für das Leben des Patienten und seiner Mitmenschen. Allerdings kann die Gefahr auch steigen, wenn der Arbeitgeber nicht informiert ist – wie im Fall des Kopiloten der Germanwings.
Die Halacha kennt keine besondere berufsbedingte Schweigepflicht, dafür aber eine allgemeine Schweigepflicht. Im säkularen Gesetz leitet sich die Schweigepflicht aus einer Transaktion zweier Parteien ab: Ein Patient geht zum Arzt, ein Steuerzahler zum Steuerberater, ein Angeklagter zum Anwalt, der Pate beichtet beim Priester und so weiter. Die Schweigepflicht entsteht also aus einem Geschäft. In der Halacha jedoch ist die Pflicht, Geheimnisse nicht preiszugeben, von jeglichen geschäftlichen Transaktionen unabhängig.
üble NAchrede Verursacht die Preisgabe eines Geheimnisses ökonomischen Schaden, dann fällt dies unter das Verbot der üblen Nachrede – Laschon Hara. Bekanntlich verbietet die Tora, über andere Böses zu sagen. Ökonomisch schädigende Rede ist ebenfalls Laschon Hara, auch wenn nichts Übles gesagt wird. Dies wird auch in den Sprüchen Salomons (11,13) betont: Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus; aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Das Stichwort ist »rachil«, das einen umhergehenden Verleumder oder Lästerer bezeichnet.
Die Preisgabe von Geheimnissen ist nicht nur wegen des potenziellen finanziellen Schadens untersagt. Auch wenn man lediglich eine persönliche Information anvertraut bekommen hat, darf man diese nicht ohne deutliche Erlaubnis weitergeben. Das entnimmt der Talmud (Joma 4b) aus dem Vers (3. Buch Mose 1,1): »Und Er rief Mosche, und der Ewige redete zu ihm von der Stiftshütte aus«, auf den das Wort »lemor« folgt. Üblicherweise übersetzen wir »lemor« als »und sagte«, doch der Talmud liest es diesmal als »zu sagen«. Das heißt, dass diese Worte nicht nur vom Ewigen an Mosche gesprochen wurden, sondern er ausdrücklich damit beauftragt wurde, sie weiterzugeben. Daraus wird gefolgert, dass Mosche ohne diesen Auftrag keine Erlaubnis bekommen hätte, diese Worte weiterzugeben.
Das deutsche Gesetz kennt Ausnahmen bei der Schweigepflicht. Die wichtigsten Ausnahmen sind ein Notstand gemäß Paragraf 34 StGB – oder eine schwerwiegende Straftat, die nach Paragraf 138 StGB anzeigepflichtig ist. Auch die Halacha kennt Ausnahmen von der Schweigepflicht, und sie sind weitläufiger als im deutschen Gesetz.
Die Ausnahmen entnimmt die Halacha der vergleichenden Gegenüberstellung zweier Verbote in einem Vers. So steht unmittelbar nach dem Verbot der Laschon Hara (3. Buch Mose 19,16): »Du sollst auch nicht auftreten wider deines Nächsten Blut!« Deshalb gilt eine allgemeine Ausnahme, wenn Körperschäden oder Sachschaden durch die Preisgabe des Geheimnisses verhindert werden können.
Aussagepflicht Diese Aussagepflicht untersteht aber selbst den Gesetzen der Laschon Hara. Eine Aussage ist nur erlaubt (und verpflichtend), wenn man direkte Kenntnis einer Information hat und sie nicht auf Gerüchten beruht, wenn die Information richtig und präzise ist und wenn man kein eigennütziges Interesse und keine verleumderische Absicht hat. Zudem soll man Lösungen vorziehen, durch die man möglichst wenig preisgibt.
Droht ein Patient andere oder sich selbst zu gefährden (auch unabsichtlich), dann besteht eine Aussagepflicht. So urteilte Rabbiner Ovadia Josef (Jechawe Daat IV Paragraf 60), ein Arzt sei verpflichtet, die Behörden zu benachrichtigen, wenn ein Epileptiker einen Führerschein beantragt.
Entsprechend urteilt der Wissenschaftler Daniel Eisenberg: Ein Arzt, der bei einem Mann HIV feststellt, muss dessen Frau benachrichtigen, wenn er weiß, dass sein Patient die Infektion verschweigen will. Der Arzt kann die Frau auch warnen, indem er eine andere Diagnose nennt, die aber ebenfalls dazu führt, dass die Frau sich schützt. Eine andere wichtige Ausnahme: Die Halacha kennt kein Zeugnisverweigerungsrecht. Wird jemand von einem Gericht aufgefordert, ein Zeugnis abzulegen, dann muss er das auch tun.
Seit dem Germanwings-Absturz stellen Medien und Politiker die Frage, ob man die Schweigepflicht lockern sollte. Doch eigentlich ist diese Frage zu pauschal. In manchen Fachgebieten wiegt der pragmatische Grund für die Schweigepflicht sehr schwer. Psychologen und Psychiater sind auf Kooperation ihrer Patienten angewiesen. Wenn ein Patient nicht sicher ist, ob seine Geheimnisse geheim bleiben, wird er vieles vor dem Behandelnden verbergen. Eine Lockerung der Schweigepflicht wäre also kontraproduktiv.
Hingegen gibt es Gesundheitszustände, die man auch ohne Kooperation des Patienten durch chemische und biologische Analysen entdecken kann, wie im obigen Beispiel das HI-Virus, und ein gelockertes Berufsgeheimnis macht die Behandlung nicht unmöglich. Die Frage ist immer, ob der Vorteil der Anzeigepflicht den Schaden und den Vertrauensverlust überwiegt, den eine Aussagepflicht mit sich bringt.
Der Autor ist Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz (ORD).