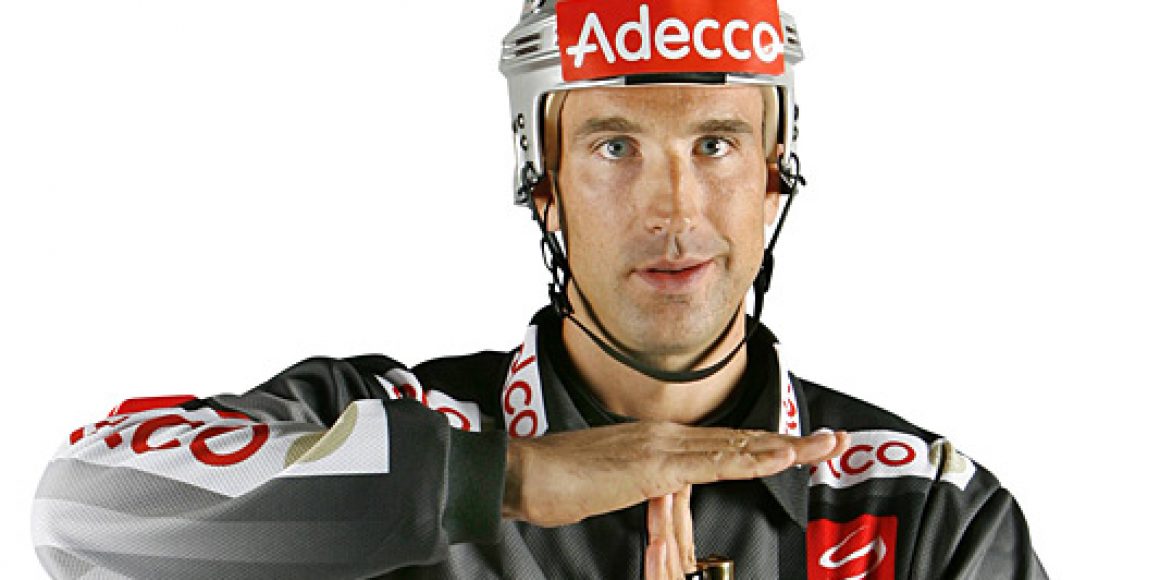Der Wochenabschnitt Wajakhel beginnt mit den Worten: »Dann versammelte Mosche die ganze Gemeinde der Kinder Israel«. Der so beiläufig klingende Anfang ist alles andere als selbstverständlich! Denn im vorangehenden haben wir vergangene Woche gelesen, wie das Volk von Gott abfiel. Selbst Mosches Bruder Aharon, der Anführer der Priester, hatte sein Vertrauen in Gott verloren und stattdessen einen goldenen Götzen anfertigen lassen, den das Volk anbetete. Wenn wir also nun lesen, dass Mosche die ganze Gemeinde versammelte, dann bedeutet dies, der Frieden und die Einheit sind wiederhergestellt – jedenfalls soweit es die vielen Opfer zuließen, die Schwerter und Plagen unter den Israeliten gefordert haben.
So ist es angesichts der dramatischen Geschehnisse nun eine Wohltat, der – zugegeben, etwas behäbigen – Schilderung zu folgen, die wir diese Woche lesen. Nachdem vor dem Zwischenfall mit dem Goldenen Kalb schon einmal in aller Ausführlichkeit die Bauanweisungen für das Ohel Mo’ed, den tragbaren Tempel für die Zeit der Wüstenwanderung, aufgezählt worden waren, werden sie nun, nach der dramatischen Unterbrechung, noch einmal wiederholt.
Einige Abweichungen allerdings gibt es. Während der erste Durchgang mit dem Schabbatgebot aufhörte, das selbst durch den Bau des Heiligtums nicht gebrochen werden darf, stehen beim zweiten Durchgang die Schabbatregelungen am Anfang. Inhaltlich unterscheiden sie sich kaum. Unser zweiter Durchgang ist knapper, sachlicher, fügt dafür aber noch das Verbot des Feuermachens hinzu, das beim ersten Mal fehlte. Dafür gibt es nun nicht mehr die feierliche Bezeichnung des Schabbats als Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel und seine Begründung durch den siebten Tag der Schöpfung, an dem Gott ruhte.
Schabbatopfer Uns ist heute die zentrale Bedeutung des Schabbats derart selbstverständlich, dass wir uns kaum wundern, wo und wie dieses Gebot in der Tora auftaucht. Gerade im Zusammenhang mit dem Heiligtum aber ist dies überraschend. Schließlich wurden hier auch – und gerade! – am Schabbat Opfer gebracht, Lampen angezündet, wurde Feuer geschürt und Fleisch gebraten. Außerhalb dieses Heiligtums aber ist die Arbeitsruhe am Schabbat zu halten, zu der eben auch der Bau des Heiligtums selbst gehört, solange es noch nicht funktionsfähig ist.
Diese Spannung wird verständlicher, wenn wir uns klarmachen, dass sich hier eine Heiligkeit des Raums und eine Heiligkeit der Zeit gegenüberstehen. So zentral in biblischer Zeit der Tempel, das Heiligtum im Raum, auch war, so wurde doch das Judentum über 2.000 Jahre von der Heiligkeit der Zeit erhalten. Indem wir Schabbat und Feiertage halten, Zeit vom Alltag absondern und sie Gott widmen, schaffen wir durch diese heilige Zeit an jedem Schabbattisch und in jeder Synagoge einen heiligen Raum. Das Judentum steht heiligen Räumen ambivalent gegenüber. Dies wird auch an der massiven Skepsis gegenüber einer Wiedererrichtung des Tempels und der Fortsetzung des Tieropferkults deutlich, die beileibe keine Besonderheit der Moderne sind. Die allgemeine Tendenz ist, dass der Tempel nicht von uns Menschen, sondern erst in der messianischen Zeit erbaut werden wird und dann auch keine Tieropfer mehr in ihm stattfinden.
Hierarchie Wir müssen uns dieser klaren Hierarchie im Judentum erinnern: Die heilige Zeit ist das Erste. Erst aus sich heraus schafft sie – zeitweilige – heilige Orte und bildet den notwendigen Maßstab, um die vielen Um- und Neubauten der jüdischen Gemeinden in Deutschland heute richtig einzuschätzen. Da, wo die neuen Synagogen die ganze Gemeinde ansprechen und dabei helfen, eine Heiligkeit in der Zeit zu stiften, eine Heiligkeit von Schabbat und Feiertag, die in den Familien und in der Synagoge einen heiligen Raum zu schaffen vermag, der auch auf die Woche ausstrahlt und ein jüdischen Leben im Alltag zu formen hilft, da sind diese Bauten gut und hilfreich.
Die Gebäude sind nicht das Eigentliche, sondern nur Hilfsmittel für ein jüdisches Leben in der Zeit, im Rhythmus von Schabbat und Werktag. So sagt schon die jüdische Tradition vom Heiligtum in der Wüste, dass Gott es nicht brauche, ja es auch ursprünglich gar nicht vorgesehen hatte, dass er aber angesichts des Abfalls Israels und der Anbetung des Goldenen Kalbs sah, dass Israel dieses Zeichen der physischen Nähe Gottes brauche.
Heute bezeichnen mitunter religiöse Zionisten den Staat Israel als dritten Tempel. Und manche Säkulare feiern die Gründung des Staates gerade als Rückkehr in die Realität des Raumes nach der in ihren Augen mangelnden Verortung des Judentums. Auch hier ist es wichtig, die Prioritäten richtig zu verstehen. Nach Auffassung der jüdischen Tradition ist die räumliche Dimension zwar unverzichtbar, aber sie steht erst an zweiter Stelle, ist Mittel zum Zweck. Die Tora wiederholt es ein ums andere Mal, dass wir heilig sein und Gutes tun sollen. Heilig sein, denn Gott ist heilig, und Gutes tun, denn das ist es, was Gott von uns verlangt.
Die Autorin ist Rabbinerin der Jüdischen Gemeinde zu Berlin.