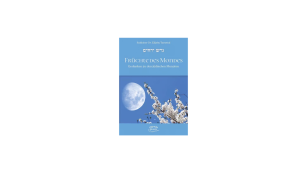Ich besuche zurzeit hier in Israel viele »Schiwas«, Trauerzusammenkünfte von Familien, die ihre Kinder als Soldaten im Krieg verloren haben. Mit Angst und Beklemmung betrete ich ihre Häuser. Ich weiß nicht genau, was ich sagen soll, um die Menschen zu trösten – besonders angesichts der momentanen, schrecklich ernüchternden politischen Entwicklungen dieser Kämpfe: eines Geiselabkommens, bei dem zahlreiche hochgefährliche Terroristen freigelassen werden. Ich fürchte, dass die Eltern sich fragen, ob ihre Kinder umsonst gestorben sind.
Doch oft ist es anders. Die Eltern sind zwar tieftraurig, schöpfen jedoch Kraft aus dem Gefühl, dass ihre Kinder ihr Leben für eine gute Sache geopfert haben: Sie empfinden die Verteidigung Israels als eine große Mizwa aus der Tora, für die ihre Kinder ihr Leben gegeben haben. Sie kämpften und starben zur Bewahrung des jüdischen Volkes, ihres Glaubens und ihres Heimatlandes. Sie sind für sie wahre Märtyrer. »Unsere Jungen sind die modernen Makkabäer«, sagten mir die Eltern. Der Mut ihres Sohnes entspringe dem hohen Wert, den Juden der Erhaltung des Lebens beimessen.
Biblische Wurzeln
Ich suche nach unseren biblischen Wurzeln. Was motiviert uns, in diesem Land zu leben, dafür zu kämpfen und notfalls dafür zu sterben? Die Tora gibt klare Antworten. Unsere wahre treibende Kraft ist unsere spirituelle Widerstandsfähigkeit.
Wir sind sowohl ein Glaube als auch ein Volk. In Israel verschmelzen unsere nationale Pflicht als Bürger und unser spirituelles Wachstum, das wir hier durch die Heiligkeit unseres Landes erleben. Diese Dinge bilden die Grundlage für die Bewahrung unserer Identität – selbst wenn dies einen hohen Preis fordert.
Religion kann gesellschaftliche Integration fördern, doch wenn sie radikal wird, führt sie zu Konflikten.
Religion kann also gesellschaftliche Integration fördern, doch wenn sie radikal wird, führt sie zu Konflikten. Gerade die Faszination mit dem Märtyrertum erzeugt weltweit immer wieder Spannungen.
Die jüdische Auffassung vom Märtyrertum heißt »Kiddusch HaSchem«, die Heiligung des Namens Gʼttes. Kann dieses Märtyrertum mit einer demokratischen Positionierung innerhalb der Gesellschaft verbunden werden? Aus jüdischer Perspektive ist dies gut möglich. Denn wir kennen weder Mission noch Evangelisation. Wir ziehen nicht hinaus, um andere von unserer religiösen Wahrheit zu überzeugen. Missionarischer Eifer ist in einer offenen Gesellschaft äußerst destabilisierend, insbesondere wenn er mit Aggression und Gewalt einhergeht.
Beim jüdischen Märtyrertum geht es jedoch um eine Selbstaufopferung im Sinne des Festhaltens an der eigenen Identität – obwohl dies oft erhebliche Einbußen in Bezug auf Karriere und gesellschaftlichen Erfolg bedeuten kann. Die jüdische Sicht auf Opferbereitschaft ist also grundlegend anders. Kiddusch HaSchem, die Heiligung des Namens Gʼttes, bedeutet, auch wenn es hart ist, ein ethisches und moralisches Leben zu führen – nicht andere zu opfern.
Channa und ihre sieben Söhne
Die jüdische Märtyrergeschichte, wie die von Channa und ihren sieben Söhnen, die sich weigerten, sich vor einem Götzen zu verbeugen, und vor den Augen ihrer Mutter abgeschlachtet wurden, zeigt Opferbereitschaft ohne aktive Aggression. Andere als Glaubenstat zu töten, wird im Judentum als Mord betrachtet, während passives Märtyrertum – das Festhalten an der eigenen Identität trotz Unterdrückung – geehrt wird.
Diese Haltung hat Juden in der Diaspora geholfen, sich zu integrieren, ohne die eigene Identität zu verlieren. Juden befolgten die eigenen Werte, ohne anderen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Wahre Toleranz in einer pluralistischen Gesellschaft bedeutet, die Unterschiede zu den anderen zu ertragen.
Das jüdische Modell friedlicher Selbstaufopferung und moralischer Standhaftigkeit kann zur Bereicherung und Integration in der modernen Gesellschaft beitragen. Die israelischen Familien der gefallenen Soldaten sind das beste Beispiel dafür.