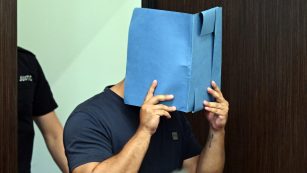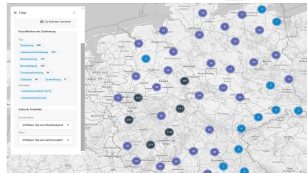Das Programm könnte kaum enger getaktet sein: Wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstagnachmittag mit einem Flugzeug der Luftwaffe nach Warschau reist, wird ab Mittwochfrüh bis zum späten Abend ein Termin auf den anderen folgen.
Auch handelt es sich bei der Reise des Bundespräsidenten nicht um eine Routinevisite, bei der die üblichen Freundlichkeiten ausgetauscht werden. Denn er und seine Ehefrau Elke Büdenbender nehmen auf Einladung des polnischen Präsidenten Andrzej Duda am Mittwoch gemeinsam mit dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog an der Gedenkfeier anlässlich des 80. Jahrestags des Aufstands im Warschauer Ghetto teil. Begleitet wird Steinmeier bei seinem Besuch unter anderem von Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.
programm Neben bilateralen Gesprächen mit Duda und Herzog stehen unter anderem ein Treffen mit Überlebenden aus dieser Zeit an, ein Besuch des Gedenkgottesdienstes in der Nożyk-Synagoge, dem einzigen noch existierenden jüdischen Gotteshaus aus der Vorkriegszeit, in dem noch Gottesdienste stattfinden, sowie ein Rundgang durch das Museum der Geschichte der polnischen Juden »POLIN«, das gerade eine Ausstellung von erst im Dezember 2022 entdeckten Fotos vom Aufstand im Ghetto zeigt, die damals ein polnischer Feuerwehrmann aufgenommen hatte. Das Gedenken endet am Abend mit einem Konzert israelischer und polnischer Musikerinnen und Musiker im Nationalen Staatstheater in Warschau.
27 Tage lang hatten im Frühjahr 1943 Hunderte Jüdinnen und Juden erbitterten Widerstand geleistet.
Doch ein Termin ist von ganz besonderer Bedeutung, und zwar die Teilnahme an der Gedenkfeier anlässlich des 80. Jahrestags des Aufstands im Warschauer Ghetto am Mittwochmittag. Denn erstmals wird ein deutsches Staatsoberhaupt am »Denkmal der Helden« dort eine Gedenkrede halten, was angesichts des Ortes und der Geschehnisse eine Herausforderung ist – schließlich hatten sich am 19. April 1943 die noch verbliebenen Bewohner des 1940 von der deutschen Besatzungsmacht zwangsweise eingerichteten Ghettos gegen ihre drohende Deportation zur Wehr gesetzt.
kniefall Hier hatte Bundeskanzler Willy Brandt mit seinem Kniefall im Dezember 1970 ein unvergessliches Zeichen der Versöhnung gesetzt. Deshalb ist den Worten Steinmeiers viel Aufmerksamkeit gewiss.
27 Tage lang hatten im Frühjahr 1943 dort wenige Hundert Jüdinnen und Juden erbitterten Widerstand geleistet. »Es war eine Überraschung für die Deutschen«, brachte es 2008 Marek Edelman, einer der wenigen Überlebenden des Aufstands, in einem Gespräch auf den Punkt. »Sie hatten offenbar vor, das Ghetto bis zum Geburtstag Hitlers einen Tag später, am 20. April, zu liquidieren. Sie glaubten offenbar, dass sie es im Laufe dieses einen Tages schaffen würden. Aber wie sich dann gezeigt hat, war das nicht möglich.«
SS-, Wehrmachts- und Polizeieinheiten reagierten mit beispielloser Brutalität. Mit Flammenwerfern fackelten sie ganze Straßenzüge ab, ermordeten 13.000 Menschen vor Ort. Wer nicht fliehen konnte, wurde anschließend verschleppt und in einem der Vernichtungslager umgebracht. Am 16. Mai war der Aufstand niedergeschlagen.
SS-, Wehrmachts- und Polizeieinheiten reagierten mit beispielloser Brutalität.
»Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr«, meldete der SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei, Jürgen Stroop, verantwortlich für die »Großaktion«, nach Berlin. Und die größte jüdische Gemeinde Europas, die vor 1939 über 400.000 Menschen gezählt hatte, war so gut wie ausgelöscht.
verbrechen Es ist nicht das erste Mal, dass Steinmeier zum Schauplatz des Geschehens fährt. Bereits im Juni 2018 hatte der Bundespräsident anlässlich seiner Teilnahme an der Konferenz »Polen und Deutschland in Europa« jeweils einen Kranz vor dem Warschauer Ghetto-Ehrenmal und dem Denkmal des Warschauer Aufstands von 1944 niederlegt. Damit reagierte er auf die damals geäußerten Vorwürfe der nationalkonservativen Regierungspartei Prawo i Sprawiedliwość (PiS), zu Deutsch: Recht und Gerechtigkeit, die Deutschland mehrfach vorwarf, die Verbrechen der Nazi-Zeit zu leugnen und die Verantwortlichkeit für die zwischen 1939 und 1945 an den Juden verübten Gräueltaten auf die Polen abzuwälzen.
Begleitet wird Steinmeier bei seinem Besuch auch von Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Im Sommer 2022 gab es erneut Verstimmungen. So hatte Polen zum 83. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs ein Gutachten vorgelegt, wonach die von den Deutschland verursachten Schäden auf 1,3 Billionen Euro beziffert werden. Deswegen erklärte man, von Berlin Reparationen fordern zu wollen. Die Bundesregierung lehnt diese jedoch ab. Für sie ist die Frage mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag über die außenpolitischen Aspekte der deutschen Einheit abgeschlossen, man sieht daher keine Rechtsgrundlage.
Damit war die Sache aber noch lange nicht vom Tisch. Noch im Januar erhob Polens Vize-Außenminister Arkadiusz Mularczyk schwere Vorwürfe. »Deutschland verfolgt keine freundliche Politik gegenüber Polen, sie wollen hier ihren Einflussbereich ausbauen und behandeln Polen wie einen Vasallen-Staat.«
Auch die Anwesenheit von Israels Staatspräsident Isaac Herzog anlässlich der Gedenkfeier ist von zentraler Bedeutung.
Aber auch die Anwesenheit von Israels Staatspräsident Isaac Herzog anlässlich der Gedenkfeier ist von zentraler Bedeutung, markiert sie doch einen Neuanfang. Denn mehrere Jahre hatte zwischen Jerusalem und Warschau diplomatische Eiszeit geherrscht.
neuregelung Streitpunkte waren unter anderem eine administrative Neuregelung, die die Restitution von enteignetem jüdischen Eigentum aus der Zeit der deutschen Besatzung unmöglich machte, sowie das »Holocaust-Gesetz« von 2018, das Äußerungen über eine Mitverantwortung von Polen an der Vernichtung der Juden unter Strafe stellte.
Erst Ende März hieß es daher – trotz anderer Streitpunkte – aus dem israelischen Außenministerium: »Die Krise ist vorbei.« ja