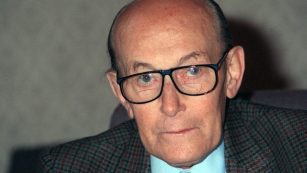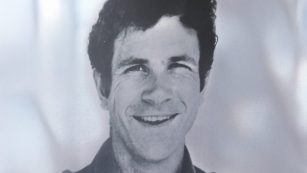Ich bin auf Besuch in Berlin, und seit Tagen bekomme ich E-Mails von meinen Freunden in San Francisco. Sie verstehen nicht, was in Deutschland passiert. »Bist du okay?«, fragen sie. »Das ist ja alles schrecklich.«
Auf einer pro-palästinensischen Veranstaltung in der Stadt greifen Demonstranten ein israelisches Ehepaar an. Auf Transparenten liest man: »Kindermörder Israel«. Pro-Israel-Demonstranten schallen Rufe entgegen wie: »Hamas, Hamas, Juden ins Gas«. Und niemand geht auf die Barrikaden. Es gibt keinen kollektiven Aufschrei. »Was ist da los?«, fragen meine Freunde.
offiziell Wahrscheinlich ist die Situation für sie umso schwerer zu verstehen, als sie partout nicht in ihr neues Deutschlandbild passen will. Meine Freunde besuchen das Land häufiger, auch und gerade, obwohl ihre Familien einst von dort fliehen mussten. Sie suchen nach Gräbern und alten Häusern, sehen das Holocaust-Mahnmal und das Jüdische Museum in Berlin, die Gedenkstätten und große neue Synagogen. Sie halten diese Bauten und Anlagen für den Ausdruck eines bewussten Umgangs mit der Geschichte – einer von Empathie getragenen Auseinandersetzung der deutschen Bürger.
Mit diesem Bild lässt sich nur schwer vereinbaren, dass ein nicht zu unterschätzender Anteil dieser Bürger kaum noch Hemmungen hat, antisemitische Tiraden abzuspulen, oft unter dem Hinweis, man dürfe ja wohl die israelische Politik kritisieren. Und noch weniger, dass es dagegen kaum Proteste gibt. Dass die Mehrheit es schweigend hinnimmt, dass Juden in Deutschland mit Bedrohungen, Beleidigungen, Friedhofsschändungen und Schmierereien an ihren Einrichtungen und immer öfter mit Gewalttätigkeiten leben. Dass kaum jemand Empathie aufbringt.
kluft Meine Freunde haben das offizielle Bild in ihren Köpfen. Das Bild Deutschlands, dessen Regierung sich vorbildlich zur Geschichte und zu ihrer Verantwortung daraus bekennt. Doch die Kluft zwischen der Regierungshaltung und der des Volkes wächst von Jahr zu Jahr. Als ich in den letzten Jahren seines Lebens mit meinem Mann in Deutschland unterwegs war, hat mich gequält, mit welcher Kälte manche Gesprächspartner reagierten, wenn sie erfuhren, dass er emigriert und seine Familie in der Schoa ermordet worden war.
Ein ähnliches Gefühl beschleicht mich heute bei Diskussionen über Israel, oder wenn ich Kommentare lese oder höre, die sich mit jüdischen Themen beschäftigen. Ob es Beschneidung und Schächtung sind, die Entführung und Ermordung der drei israelischen Teenager oder die Geschehnisse im Gazastreifen – oft schimmert durch die Worte eine Kaltschnäuzigkeit Juden gegenüber, die ich benennen, aber schwer greifen kann, eine Haltung, die über analytische Distanz und Objektivität hinausgeht.
Sie wird getragen von Geschichtsvergessenheit und einer Ignoranz, die man in manchen Fällen als geistige Verrohung bezeichnen muss. Wie kann es sein, dass Menschen so wenig Empathie mit den Juden haben? 70 Jahre nach der Schoa?
verankert Antisemitismus ist kein Vorurteilssystem unter vielen, sondern tief in den abendländischen Denk- und Gefühlsstrukturen verankert, sagt Monika Schwarz-Friesel, die zusammen mit Jehuda Reinharz das Buch Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert herausgegeben hat, das – neben ihrer anderen neuen Publikation Aktueller Antisemitismus – ein Phänomen der Mitte – wohl bisher wichtigste Buch zum sekundären Antisemitismus. Man müsse sich immer wieder klarmachen, dass die Verurteilung von Antisemitismus erst wenige Jahrzehnte alt sei.
»50 Jahre Aufklärungsarbeit stehen über 1900 Jahren judäophober Kultur gegenüber. Die Gesellschaft muss dies zunächst realisieren und akzeptieren«, so Schwarz-Friesel. Die Berliner Wissenschaftlerin zitiert in ihrem Buch Briefe von Rechtsanwälten und Ärzten, angefüllt mit antijüdischen Stereotypen, unterzeichnet mit vollem Namen. Denn als Antisemiten sehen sich diese geistigen Brandstifter nicht. Dabei arbeiten sie den Schlägern und den Hakenkreuzschmierern zu. Und die Mehrheit lässt beide Seiten gewähren. Und merkt nicht, dass sie auch damit etwas tut.