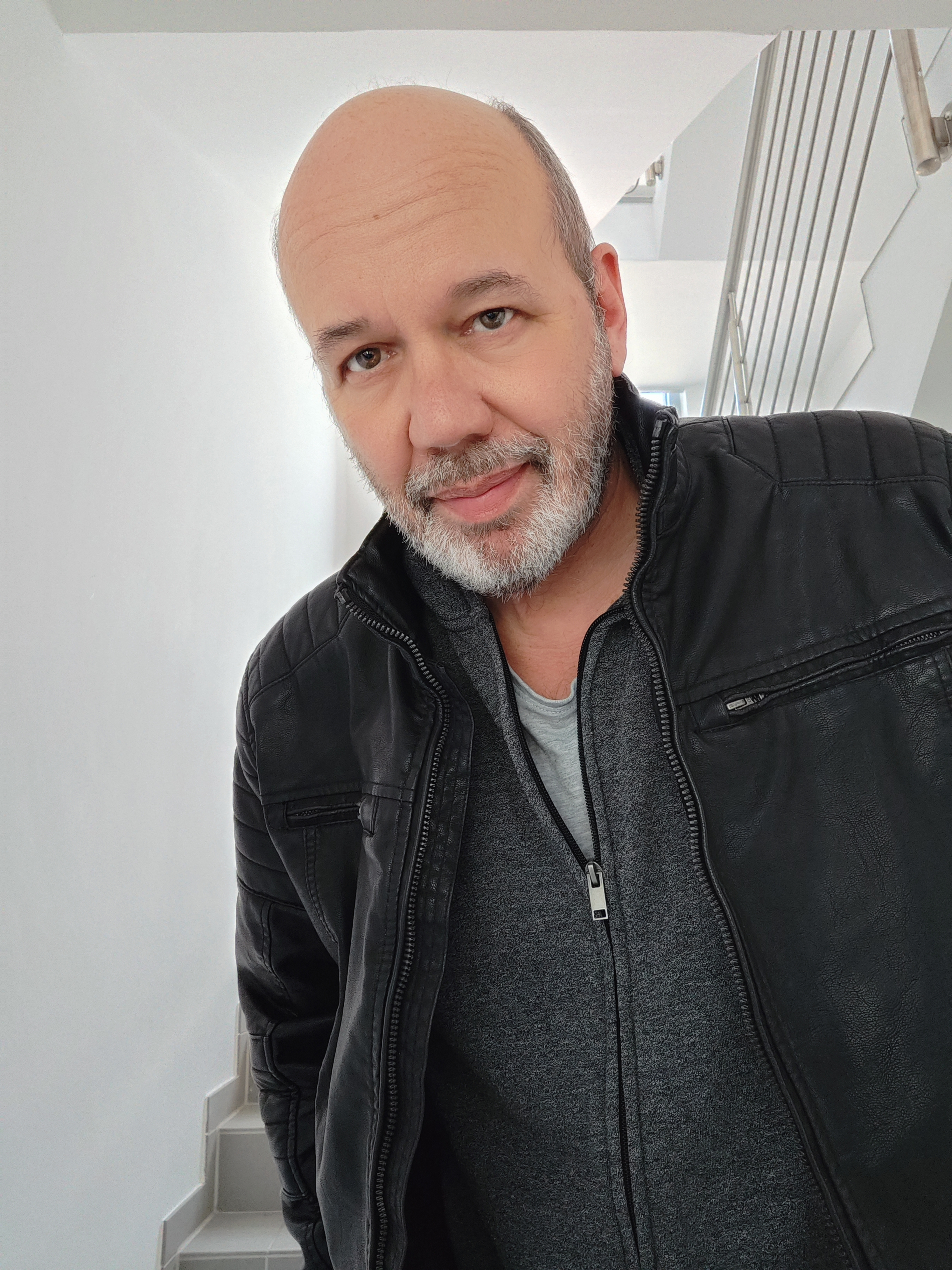Am Samstag jährt sich der Volksaufstand von 1953 und dessen brutale Niederschlagung zum 70. Mal. Im Gespräch mit der Jüdischen Allgemeinen beleuchtet der Historiker und Rabbiner Andreas Nachama die Hintergründe, Konsequenzen und jüdische Aspekt des Aufstands.
Rabbiner Nachama, der Volksaufstand von 1953 ist eines der wichtigsten deutschen Ereignisse in der Nachkriegsgeschichte. Durch die Niederschlagung und Todesurteile gegen Aktivisten kamen mindestens 55 DDR-Bürger um. Hatten die Protestierer eine Chance, die geforderte Freiheit zu erlangen?
Wer sich die Niederschlagung der Aufstände in Ungarn 1956 und in der CSSR 1968 durch die sowjetischen Truppen vor Ort vor Augen führt, der kann ermessen, dass die Chance eines erfolgreichen Volksaufstandes 1953 nicht gegeben waren.
Welche konkreten Ursachen hatte der Volksaufstand?
Trotz des Todes von Stalin im März 1953 beschließt die SED-Führung im Mai 1953 eine etwa 10-prozentige Erhöhung der Arbeitsnorm. Da die Löhne nicht angepasst wurden, war das eine gravierende Verschlechterung der Lohn- und Arbeitsbedingungen. An den Tagen vor dem 17. Juni wird zunächst an einigen Baustellen in Ost-Berlin die Arbeit niedergelegt. Schließlich waren es DDR-weit ca. 700 Betriebe oder Orte, die von den Arbeitsniederlegungen beziehungsweise von Protesten betroffen waren.
Nach dem 17. Juni zog die DDR-Führung Konsequenzen. Was passierte?
Der Unterdrückungsapparat wurde unter dem Vorwand perfektioniert, der Aufstand sei ein von Faschisten von außen, sprich von West-Berlin und der Bundesrepublik, hereingetragener Versuch einer Konterrevolution. In Betrieben und Verwaltungen wurden unter dem Namen »Kampfgruppen der Arbeiterklasse« paramilitärische Organisationen aufgebaut. Gleichzeitig wurden innerhalb der SED auf allen Ebenen führender Funktionäre durch vermeintlich regimeergebenere ersetzt.
Haben die DDR und die Sowjetunion den Bürgern Ostdeutschlands mit der brutalen Niederschlagung die Lust auf den Sozialismus genommen? War das Vorgehen aus der Perspektive einer menschenverachtenden, kommunistischen Diktatur klug? Welche Reaktion wäre aus dieser Sicht die Alternative gewesen?
Das Sowjetsystem basierte im Gegensatz zum demokratischen Sozialismus auf autoritären »Top-Down«-Strukturen, die ein Handeln mit geheimdienstlichen Maßnahmen ohne rechtsstaatliche oder ethische Erwägungen ermöglichten. Die Frage nach einer Alternative in einem solchen System kann ich nicht beantworten. Das war wohl unvorstellbar.
Wie wurde das Thema nach 1953 innerhalb der DDR behandelt, zum Beispiel an Schulen und Universitäten?
Meines Wissens wurde erst Jahrzehnte später, nämlich 1974, in einer Publikation zur Geschichte der DDR, der Versuch unternommen, die bis dahin gängige und in den Massenmedien wirksam verbreitete regimetreue Darstellung eines »konterrevolutionären Putschversuches« von außen als Geschichtsbild auch in einem sich geschichtswissenschaftlich gebenden Werk zu etablieren und die gewaltsame Niederschlagung insbesondere durch die sowjetischen Truppen als Hilfe des »proletarischen Internationalismus« zu bemänteln.
Laut DDR-Staatspropaganda war es ein »faschistischer Putschversuch«. Glaubten die Juden in Ostdeutschland dieser Sicht?
Erich Nehlhans, der erste Vorstandsvorsitzende und das spätere für Kultus zuständige Vorstandsmitglied der Berliner Jüdischen Gemeinde war im März 1948 von der sowjetischen Geheimpolizei verhaftet worden und über das Speziallager in Sachsenhausen in die Sowjetunion verbracht worden. Er wurde in Berlin niemals wieder gesehen. Auch vor dem 17. Juni 1953 hatte sich eine größere Anzahl von Juden aus der DDR in den Westen abgesetzt, weil es in verschiedenen Ostblockstaaten Schauprozesse gegen Juden gegeben hatte. Das alles bildete den Bewusstseinsstand der Juden in Berlin und Ostdeutschland. Ob es auch unter Juden Personen gab, die der regimetreuen Version Glauben schenkten, vermag ich nicht zu sagen.
Inwieweit waren jüdische Gemeinden oder Individuen in die Proteste involviert? Waren sie von der Niederschlagung betroffen?
Die nach Ende des Slansky-Prozesses in der DDR verbliebenen und in jüdischen Gemeinden engagierten Juden waren - soweit ich das einschätzen kann - in diesem Zeitraum politisch nicht engagiert.
Gibt es weitere jüdische Aspekte in Zusammenhang mit dem 17. Juni?
Es findet sich zu Rosch HaSchana 1953 ein Gemeindebrief an alle Mitglieder von dem die jüdischen Gemeinden in Ost-Berlin und der DDR betreuenden Rabbiner Martin Riesenburger, der darauf schließen lässt, dass sich Mitte 1953 die dort verbliebenen Juden neu organisiert haben und ein neues jüdisches Leben sich sehr langsam, aber doch stetig in einer grundsätzlich religionsfeindlichen Gesellschaft entwickeln konnte.