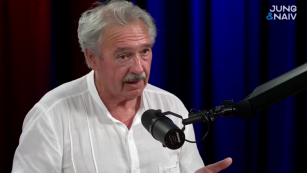Was soll eigentlich ein »jüdischer Garten« sein? Das wurde ich oft gefragt, wenn ich erzählte, dass ich zur Expertenkommission gehörte, die bei den »Gärten der Welt« in Berlin-Marzahn auch einen jüdischen Garten plante.
VERTREIBUNG Eine gute Frage, denn während bestimmte Kulturen die Beschäftigung mit der Natur zur spirituellen Erfahrung gemacht haben, scheint solch ein Bestreben dem Judentum fremd. Zumal es Juden historisch oft nicht erlaubt war, Land zu besitzen. Auch die Geschichte der Vertreibung lehrt, dass Juden oft nicht die Zeit hatten, so etwas Langfristiges wie einen Garten anzulegen – schon gar nicht als kontemplativen Ort.
Juden hatten durch Vertreibung
oft nicht die Zeit, so etwas Langfristiges
wie einen Garten anzulegen.
Dennoch finden sich bereits in der Tora viele Hinweise zur Natur. So ist der erste Ort, den die Menschheit bewohnt, der Paradiesgarten, Awraham sitzt im Baumhain Mamres, und die Opferungen, die im Tempel stattfanden, beziehen sich auch auf den Ertrag des Feldes. Auch religiöse Fragen, etwa nach Besamim, der Duftpflanze, die man am Schabbatausgang riecht, berühren Garten- und Landwirtschaft. Und nicht zuletzt gibt es die Kibbuzim, die Israel zum Agrarland machten.
WETTBEWERB Den Berliner Wettbewerbsteilnehmern standen also viele Möglichkeiten offen, um den einen Jüdischen Garten zu planen. Der leitende Gedanke war, dass ein solcher Garten sehr wohl das Judentum oder zumindest einzelne Aspekte räumlich erfahrbar machen kann. Entsprechend wurden sowohl historische, mystische, als auch religiös idealtypische oder symbolische Gartenentwürfe von den Wettbewerbsteilnehmern eingereicht.
Am Ende gewann ein »Mitmach-Garten«. Die Grundidee: Auf einer von Wegen durchzogenen Fläche werden Nutz- und Zierpflanzen angebaut, die einen Bezug zum Judentum haben. Zudem werden zwei Pavillons errichtet, in denen auch Feste durchgeführt werden können. Denn zum sinnlichen Erleben des Judentums gehören auch Feiern.
Der Autor ist Rabbiner in Frankfurt/Main und beriet die »Gärten der Welt« in Berlin.