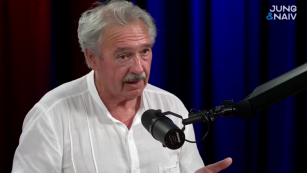Das Vertrauen in die Polizei ist groß, so sagen immer wieder Umfragen. Größer als das Vertrauen in die Presse, in die Wissenschaft, in viele andere Institutionen des öffentlichen Lebens. Das klingt beruhigend. Aber das ist es nicht. Es ist beschwichtigend.
Man muss genauer hinsehen. Das Vertrauen mancher Teile der Bevölkerung in die Polizei ist größer als das anderer. Und es sind gerade die Minderheiten in der Gesellschaft, die Marginalisierten, die diesen Staat so dringend auf ihrer Seite wissen sollten, die dieses Vertrauen heute am wenigsten haben.
Grundrechte Die allerwenigsten Betroffenen von antisemitischen Attacken bringen es übers Herz, zur Polizei zu gehen. Nur in 20 Prozent der Fälle erstatten sie Anzeige. So gering ist das Vertrauen, das hat in der vergangenen Woche erst wieder eine Studie der EU-Agentur für Grundrechte offenbart. So groß ist die Vertrauenskrise, in der dieser Rechtsstaat steckt, in dem Woche für Woche neue rechtsextreme Vorfälle aus den Reihen der Polizei ans Licht kommen.
Bundesinnenminister Seehofer hat schon Recht: Es braucht jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung, die beziffert, wie stark rassistische Vorurteile in der Polizei verbreitet sind. Solche Umfragen sind immer methodisch angreifbar. Da füllen Beamte einen Fragebogen aus. Wie ehrlich, ist eine Frage. Welche Schlüsse die Forscher ziehen, ist eine weitere Frage. Schlimmstenfalls sieht am Ende nur jeder Beobachter seine schon vorher bestehende Meinung bestätigt.
Aber Horst Seehofer hat es natürlich in der Hand, etwas viel Effektiveres zu tun, ebenso wie übrigens seine 16 Länderkollegen. Die rechtsextreme Szene in Deutschland wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Reichsbürger-Stammtische, Neonazi-Konzerte: Dazu gibt es Akten, auch Namenslisten. Wenn die Verfassungsschützer nun die Erlaubnis bekämen, die Personallisten der Polizei einmal dagegen abzugleichen – dann wäre dies nicht Ausdruck eines üblen Generalmisstrauens, sondern rechtsstaatlich das Mindeste.
Der Autor ist Redakteur der »Süddeutschen Zeitung«.