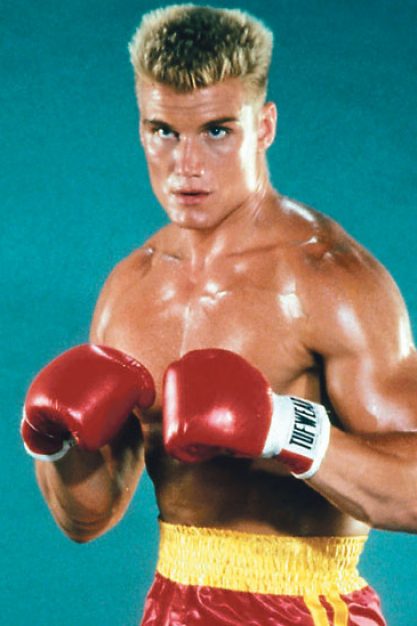Der Jid fangt mit dem Goi an», schreibt Abraham Tendlau 1860 in seiner Sammlung Jüdische Sprichwörter und Redensarten und erläutert: «Goi, biblisch: der Fremde, Nichtjude; später auch der nicht streng religiöse Jude.»
Der Ausdruck «Goi» – in der femininen Form «Goje» oder «Goite» – findet sich auch in etlichen, teils ironischen Redewendungen bei Werner Weinberg (Die Reste des Jüdischdeutschen, 1973). «Was fängt der Jud mit’m Goi an! bedeutet: Wozu muss man sich mit dem Nichtjuden einlassen; man zieht doch den Kürzeren. Wurde aber auch allgemein gebraucht in dem Sinne: man soll sich gar nicht mit jemandem einlassen; oder: man hätte sich nicht einlassen sollen.» «So’n Goi» bedeutet nach Weinberg: «ein besonders großer, starker, auch typisch nichtjüdisch aussehender Christ»; auch «Gewittergoi» steht für einen solchen Nichtjuden.
Von einem Juden, der die Religionsgesetze verletzt, wird gesagt: «Er ist ein großer Goi», also ein Ungläubiger, auch «Goi gomer» (vollkommener Heide). Ein «jofener Goi» dagegen ist ein freundlicher, nicht antisemitischer Christ. Der «Schabbesgoi» war traditionell der Nichtjude, der am Schabbat verbotene Arbeiten für Juden erledigte. Das Adjektiv «goiisch» erläutert Weinberg am Beispiel «goiischer Kopp», dem er augenzwinkernd hinzufügt: «einer, der schwer lernt (meistens von einem Juden gesagt)». Lillian M. Feinsilver (The Taste of Yiddish, 1970) nennt unter anderem «goiische massel» für unverdientes Glück.
«Ganz Nett» Der Kabbalaforscher Gershom Scholem berichtet am 25. April 1920 aus München seiner Mutter vom Besuch seines Großvetters: «Am Abschied hat er mich noch angenehm überrascht durch die Entdeckung eines jüdischen Antiquariats bei einer hiesigen goiischen Buchhandlung, was einige schöne Folgen hat, indem es dort wirklich billig zuzugehen scheint, da der Goi gar nicht ahnt, welch teure und gesuchte Sachen er da viele unter den Händen hat.»
Betty Scholem wiederum schrieb ihrem Sohn am 12. März 1930 aus dem Urlaubsort Meran: «Unsere Pension ist in Magenwirtschaft und Unterkunft vorzüglich, aber die Belegschaft ist ein G.N. sondergleichen.» Die Abkürzung G.N., die zuweilen scherzhaft als «ganz nett» ausgelegt wurde, steht hier für «goiische Naches» (oder «Góiennaches»), was im Jiddischen nichtjüdische, oft auch unsinnige Vergnügungen meint.
Und heute? Man kann das Thema politisch korrekt angehen, um zu zeigen, dass die Bezeichnung «Goiim» für nichtjüdische Mitglieder der Gesellschaft nicht, wie zuweilen unterstellt, pejorativ gemeint ist. (Tucholsky: «Christen sind dümmer als Juden, und werden aus diesem Grund Gojim genannt.») Die Internetseite talmud.de berichtet: «Um auf die diesbezügliche Sensibilität der christlichen Bevölkerung Rücksicht zu nehmen und jeden Verdacht auszuräumen, das Christentum würde durch das Judentum diskriminiert, wurde etwa in einer groß angelegten Rückhol-Aktion der im deutschen Sprachraum gebräuchliche Siddur überarbeitet und die Bracha ›Sche lo asani goi‹ durch ›Sche lo asani nochri‹ im Morgengebet ersetzt.»
Oder man betrachtet das Thema humorvoll, wie Alan Posener, der kürzlich in der «Welt» auf einen neueren jüdischen Witz verwies: «Wie erkennt man in Deutschland den Unterschied zwischen einem jüdischen und einem nicht-jüdischen Haushalt? Antwort: Bei den Goiim spielt man Klezmer.»