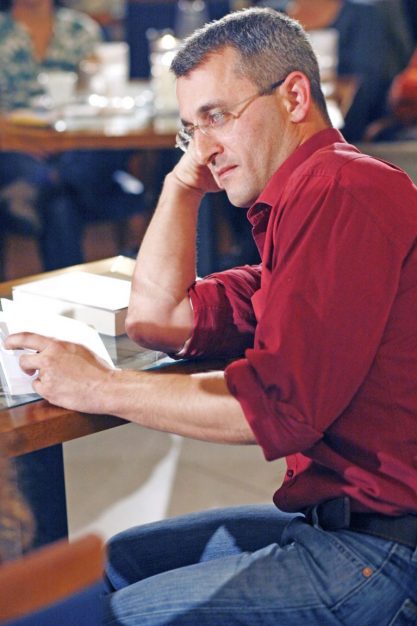Herr Nevo, die Frankfurter Buchmesse findet in diesem Jahr digital statt. Wie geht der Buchhandel in Israel mit der Corona-Krise um?
In Israel haben die Verlage in der Corona-Krise ihre Funktion nicht erfüllt, in meinen Augen haben sie versagt. Das ist wirklich traurig – die meisten Häuser haben ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt. Anstatt einen Buchmarkt digital abzuhalten, wurde er ganz abgesagt.
Buchläden sind keine essenziellen Geschäfte, also sind sie während des Lockdowns in Israel …
… geschlossen! In diesen Tagen kann man physisch nirgendwo Bücher kaufen. Man kann natürlich E-Bücher im Internet beziehen, aber das wollen viele Menschen nicht. Der Buchmarkt existiert gerade so gut wie gar nicht. Ich persönlich habe Glück, ich habe Leser in Italien, in Frankreich, in den USA. Gerade in den vergangenen zwei Monaten habe ich sehr viele Reaktionen auf Bücher bekommen, die dort in Übersetzungen aus dem Hebräischen erschienen sind, also spüre ich auch ein Feedback. Aber wenn ich mich nur auf den israelischen Markt verlassen würde ... alles, was man heute als Autor veröffentlichten kann, sind Kurzgeschichten, und zwar umsonst. Bücher erscheinen gerade kaum noch.
Wie überleben die Autoren zurzeit?
Nicht als Autoren. Es ist ohnehin nicht einfach, in Israel Künstler zu sein. Viele meiner Freunde sind während der Corona-Krise arbeitslos geworden. Einer arbeitet als Babysitter, der andere liefert Lebensmittel aus. Für viele Musiker, Schauspieler Schriftsteller ist es ein völliger Zusammenbruch, die Kulturwelt gibt es zurzeit nicht. Und viele Künstler sind jetzt sehr wütend auf die Regierung.
Manche Schriftsteller lähmt die Krise beim Schreiben. Wie ist es bei Ihnen?
Bei mir ist es umgekehrt, ich bin kreativ – das ist das Positive an der Situation. Beim ersten Lockdown in Israel war das noch leichter, denn wir dachten damals nicht, dass es so lange dauern würde wie jetzt, es herrschte Vertrauen in die Regierung. Ich jedenfalls habe während des ersten Lockdowns im Frühjahr die Rohfassung für mein neues Buch fertiggestellt. Aber ich schreibe auch jede Woche eine Kurzgeschichte für die italienische Ausgabe von »Vanity Fair«.
Wissen Sie schon, wann Ihr nächstes Buch erscheinen wird?
Nicht, bevor ein Impfstoff kommt. Ich werde jedenfalls kein Buch veröffentlichen, solange die Buchläden in Israel geschlossen sind. Vielleicht wird es auch zum ersten Mal so sein, dass ein Buch von mir im Ausland erscheint, bevor es in Israel herauskommt. Ich habe ein sehr großes Publikum in Italien, und möglicherweise kommt es dort zuerst heraus. Das ist noch unklar. Jedenfalls bin ich gerade sehr kreativ. Und ich habe auch deshalb Glück, weil ich nicht nur Autor bin. Ich gebe auch viele Workshops meiner Schreibwerkstatt.
Auf »Zoom«?
Ja, und auch in Parks. Zwischendrin haben wir uns zudem drinnen getroffen. Inzwischen sind wir wieder auf Zoom. Und die Menschen sind froh darüber, dass sie wenigstens auf diese Art und Weise zusammen sein können. Am Anfang solcher Begegnungen sehen ihre Gesichter noch bleich und traurig aus. Aber allmählich, im Verlauf des Treffens, kehrt die Farbe zurück, die Leute fangen an zu lächeln und tauschen sich über ihre Texte aus, und am Ende ist etwas passiert, das gar nicht unbedingt mit dem Schreiben zu tun hat, sondern mit dem menschlichen Bedürfnis, zusammenzusein. Das gibt auch uns, den Leitern der Workshops, ein Gefühl von Bedeutung. Ich habe mich oft wie ein Rabbi gefühlt, der eine Gemeinde hat, eine Gemeinde von Schülern, die auf etwas warten, auf Inspiration, auf den Ruf, nicht aufzugeben und kreativ zu bleiben.
Haben Sie mehr oder weniger Schüler als früher?
Bis jetzt ist die Zahl relativ konstant geblieben. Ich befürchte aber, dass, wenn es so bleibt, weniger Menschen kommen. Es herrscht Ungewissheit darüber, wie lange der Lockdown dauern wird, und in einer solchen Situation wollen Menschen keine finanziellen Verpflichtungen eingehen. Es ist nicht einfach ... Wir leben in einer sehr schweren, empörenden, sehr politischen Zeit, in der es sehr viel Wut auf die Regierung gibt. Corona ist eine schreckliche Krankheit, ich habe Freunde, die im Krankenhaus liegen, und mir macht das wirklich Angst. Und in dieser Situation funktioniert unsere Regierung nicht so, wie sie sollte. Aber Israel ist der Ort, den ich liebe. Ich möchte weder in Berlin noch in Palo Alto leben, ich möchte dafür sorgen, dass Israel dessen würdig ist, wovon die Menschen geträumt haben, die dieses Land gegründet haben.
Während des ersten Lockdowns im Frühjahr war Israel ein vorbildliches Land mit geringen Corona-Infektionsraten, das von anderen beneidet wurde. Warum sind Ihrer Meinung nach die Zahlen anschließend so stark explodiert?
Das hat verschiedene Gründe, und ich will hier nicht über Verschwörungstheorien sprechen. Aber einer der Gründe ist sicherlich, dass die Regierung in ihrer Koalition auf die charedischen (ultraorthodoxen) Parteien angewiesen ist und dass Regierungschef Benjamin Netanjahu es deshalb nicht möglich gemacht hat, das Corona-Problem in der charedischen Gesellschaft effektiv zu bekämpfen, wo die Infektionsraten prozentual am höchsten sind. Und während viele Israelis arbeitslos zu Hause sitzen, haben sie den Eindruck, dass es in der charedischen Gesellschaft immer noch größere Treffen gibt.
Und dann sind die Leute wütend auf die charedische Gesellschaft?
Ich persönlich habe ein Problem mit »Wut auf Gesellschaften«. Das sind meine Brüder! Ich habe einige charedische Schüler in meinen Workshops, und ich mag sie, ich liebe diese Menschen. In dieser Gesellschaft gibt es großartige Leute, und ich kann nicht auf alle wütend sein. Aber ich bin wütend auf ihre Führung. Die charedische Gesellschaft hört auf ihre Rabbiner, und ich finde, dass viele von ihnen sich nicht verantwortungsbewusst verhalten haben, weil sie nicht von Anfang an klargestellt haben, dass es hier um Leben und Tod geht. Ich glaube auch, dass es nach Ende dieser Krise zu großen Veränderungen in der charedischen Gesellschaft kommen und man Führungspersonen zur Rechenschaft ziehen wird. Aber Sie haben mich an einem Tag am Telefon erwischt, an dem auch ich sehr wütend bin. Wir sind im Lockdown, ich sitze hier in der Wohnung mit meinen drei wunderbaren Töchtern und meiner Frau, und wir verbringen viel Zeit zusammen ...
Wann waren Sie das letzte Mal im Ausland?
Sie streuen Salz in meine Wunden! Im November 2019 war ich in Indien, im Dezember 2019 in Moskau. Zwischen den Monaten März und Oktober 2020 hätte ich sieben Mal im Ausland sein sollen, alles wurde abgesagt … In diesem November war eine Lesereise in Deutschland geplant. Ich sehne mich sehr nach Berlin!
In »Die Wahrheit ist« – das Buch steht jetzt auf der Shortlist des internationalen Premio Lattes Grinzane – drängt Ihnen der Vorsitzende einer jüdischen Gemeinde ein dickes Buch über Schoa-Erlebnisse auf. Ist das ein Gefühl, das Sie öfters in Deutschland haben?
Die Geschichte ist komisch, aber sie hat einen wahren Kern. Die Frage, die dahintersteckt, ist: Kann ich als Israeli vor der Tatsache fliehen, dass ich Jude bin? Ohne meine Besuche im Ausland, aber besonders in Deutschland, wäre ich mir wahrscheinlich nicht darüber klargeworden, wie jüdisch ich bin und wie wichtig das für mein Selbstverständnis ist. Es gibt etwas in der jüdischen Geschichte – wenn man in Berlin die Stolpersteine im Straßenpflaster sieht, ist es sehr schwer, sich nicht als Jude zu fühlen.
In dem Buch klingt es nicht so, als ob Sie die Begegnungen mit Juden in Deutschland uneingeschränkt genießen. In der jüdischen Gemeinde zwingt man Sie, koscher zu essen, und man gibt Ihnen ein Buch, das Sie nicht wirklich wollen ...
Aber das ist eine Metapher, es geht doch nicht um mich. Lassen Sie mich einen Moment beiseite. Das, was ich in dem Buch beschreibe, ist auch ein Teil von mir. Reden wir über Zionismus: Die frühen Zionisten dachten, dass sie den Diasporajuden weit hinter sich lassen könnten. Diese Leute im Cheder mit den Schläfenlocken, dem geringen Selbstbewusstsein und der Angst vor den Nichtjuden. Sie glaubten: »Wir sind neue Menschen, braun gebrannt, stark und bewaffnet.« Aber wenn wir uns heute den Staat Israel anschauen, dann ist es ein sehr jüdischer Staat. Wir haben eine Runde gedreht und sind zu unserem Ausgangspunkt zurückgekommen. Auch mein Buch dreht eine solche Runde.
Sie schreiben also nicht über »die Juden in Deutschland«, sondern über etwas, das zu Ihnen gehört ...
Klar, das ist meine Begegnung als Israeli, der in einem dezidiert säkularen Haus aufgewachsen ist, mit meinem Judentum. Und ich frage mich dabei, wie es sich entwickelt, was es bei mir auslöst, inwiefern es mich interessiert und inwiefern ich mich zusammen mit ihm wandle. Das ist ein sehr dynamischer Prozess. 2007 war ich zum ersten Mal in Deutschland, und seitdem etwa noch zehnmal. Bei meinem ersten Besuch war es eine Begegnung mit der Geschichte. Wenn ich heute nach Berlin komme, dann treffe ich gute Freunde. Und für mich ist es an jedem Ort der Welt eine aufregende emotionale Erfahrung, mit den jüdischen Gemeinden vor Ort zusammenzutreffen. In Johannesburg zum Beispiel war es für mich eine tolle Erfahrung, zu merken, dass die jüdische Gemeinde den israelischen Schriftsteller unterstützt. Und auch mit der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und den Israelis in Berlin ist das Gespräch für mich interessant, auch wenn ich mich nie dafür entscheiden würde, in Berlin zu leben. Ich will keinen mentalen Lockdown. Ich war niemals der misanthropische Schriftsteller, der sich gerne von andern isoliert. Ich liebe Menschen, ich mag Gesellschaft. Was mir im Moment fehlt, sind meine Freunde, die ich nicht treffen kann.
Die Corona-Einschränkungen in Deutschland sind in puncto Härte mit denen in Israel nicht zu vergleichen. Was machen Sie, um damit klarzukommen?
Sport ist erlaubt. Ich war noch nie so sportlich wie jetzt. Ich laufe fast schon Halbmarathon. Hauptsache, in Bewegung bleiben.
Was können wir tun, um Israelis in dieser Situation zu unterstützen?
Jedes Gespräch, besonders mit Menschen, die einsam sind, mit älteren Menschen, mit kranken Menschen, jeder Kontakt ist essenziell. Wenn ich etwas für jemanden tun kann oder wenn jemand es für mich tut – das ist das, worum es jetzt vor allem geht.
Mit dem israelischen Schriftsteller sprach Ayala Goldmann.