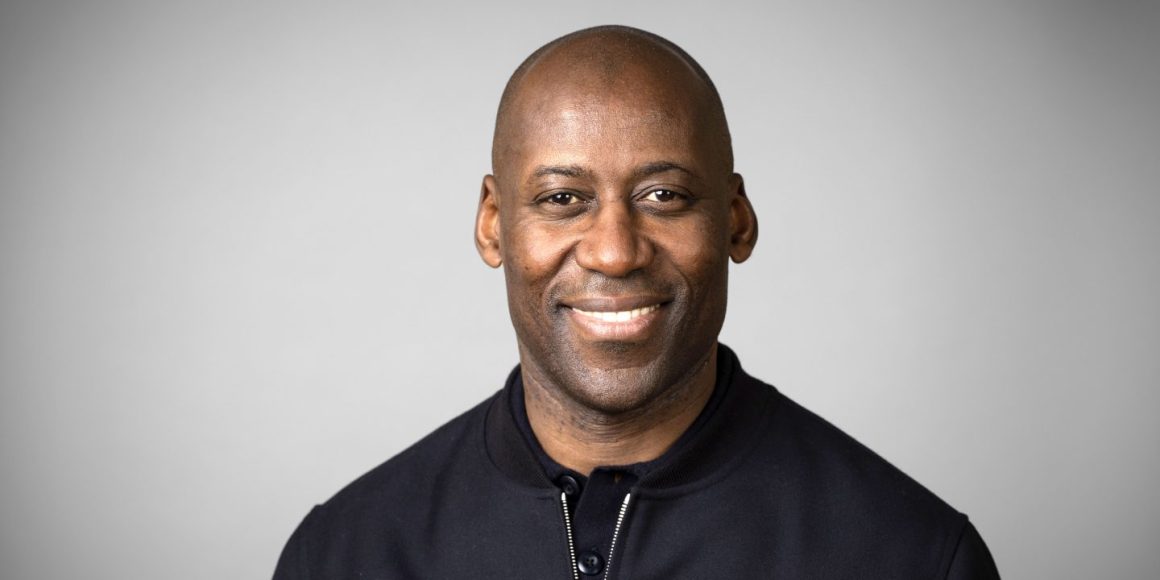Herr Chialo, Künstler in Berlin müssen neuerdings Stellung gegen Antisemitismus beziehen, wenn sie öffentlich gefördert werden wollen. Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, diese Antidiskriminierungsklausel durchzusetzen?
Das Berliner Abgeordnetenhaus hat im März 2019 das Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismus-Prävention verabschiedet. In der damaligen Umsetzungsstrategie war bereits ein Passus für Zuwendungsbescheide angedacht. Das wurde jedoch nicht umgesetzt. Dann kam der 7. Oktober. Eine Zäsur – nicht nur in Israel, sondern auch in Berlin. Nach diesem Tag war klar, dass jetzt endlich realisiert werden muss, was im Abgeordnetenhaus bereits 2019 beschlossen wurde. »Nie wieder« ist jetzt und nicht übermorgen. Der Part zur Antidiskriminierung ist bereits im Landesantidiskriminierungsgesetz klar definiert und geregelt, daher haben wir in der Klausel den Schwerpunkt auf die Definition von Antisemitismus gelegt.
Werden neue Stellen beim Senat geschaffen, um die Klausel umzusetzen?
Nein. Die Förderrichtlinien werden entsprechend ergänzt, und es gibt eine verpflichtende Selbsterklärung für die Zuwendungsempfänger. Die Klausel enthält kein grundsätzliches Verbot. Veranstaltungen werden wie bisher von den Kultureinrichtungen, Projekten und Künstlern selbst gestaltet. Wenn sich eine Einrichtung, ein Projekt oder eine Künstlerin oder ein Künstler unsicher sind, ob ein Projekt, ein Exponat oder eine Ausstellung möglicherweise bestimmte Ismen erfüllt, so kann die Frage mit der zuständigen Ansprechperson in meinem Haus besprochen werden.
Kulturverbände sprechen von einer Gesinnungsklausel …
In Teilen der Kulturszene trifft die Einführung der Klausel in der Tat auf große Kritik. Eines ist völlig klar: Die Kunstfreiheit muss natürlich gewahrt bleiben, und das wird sie auch. Es gibt aber kein Recht auf eine Bewilligung von Fördermitteln aus Steuergeldern, schon gar nicht für diskriminierende oder antisemitische Kunst. Dementsprechend gibt es auch sehr viele sehr positive Rückmeldungen. Einige Bundesländer und Städte haben bereits bei uns nachgefragt. Die Diskussion über die Einführung einer Klausel ist mir bereits aus anderen Bundesländern bekannt, und ich bin mir sicher, dass nach Schleswig-Holstein und Berlin nun weitere folgen werden. Wir sind auf dem richtigen Weg.
Kritiker halten eine Orientierung an der Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) nicht für allein maßgeblich, um Kulturförderung zu rechtfertigen. Was erwidern Sie?
Bereits das Berliner Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismus-Prävention von 2019 nimmt auf die IHRA-Definition Bezug. Der Deutsche Kulturrat hat die IHRA Ende 2023 allen Kultureinrichtungen zur Annahme empfohlen. Eine Definition, auf die sich alle einigen, wird es wohl nie geben. Die Klausel soll klar die rote Linie in Bezug auf Diskriminierung und Antisemitismus aufzeigen. Natürlich ist das gesamte Thema sehr komplex, viel diskutiert, streitbar. Aber gerade das Existenzrecht Israels ist an dieser Stelle nicht verhandelbar. Davon abgesehen, werden wir viele Befürchtungen in Bezug auf die Klausel und eine Einschränkung der Kunst- oder Meinungsfreiheit in Gesprächen und Dialogformaten ausräumen können.
Die Fragen stellte Ayala Goldmann.