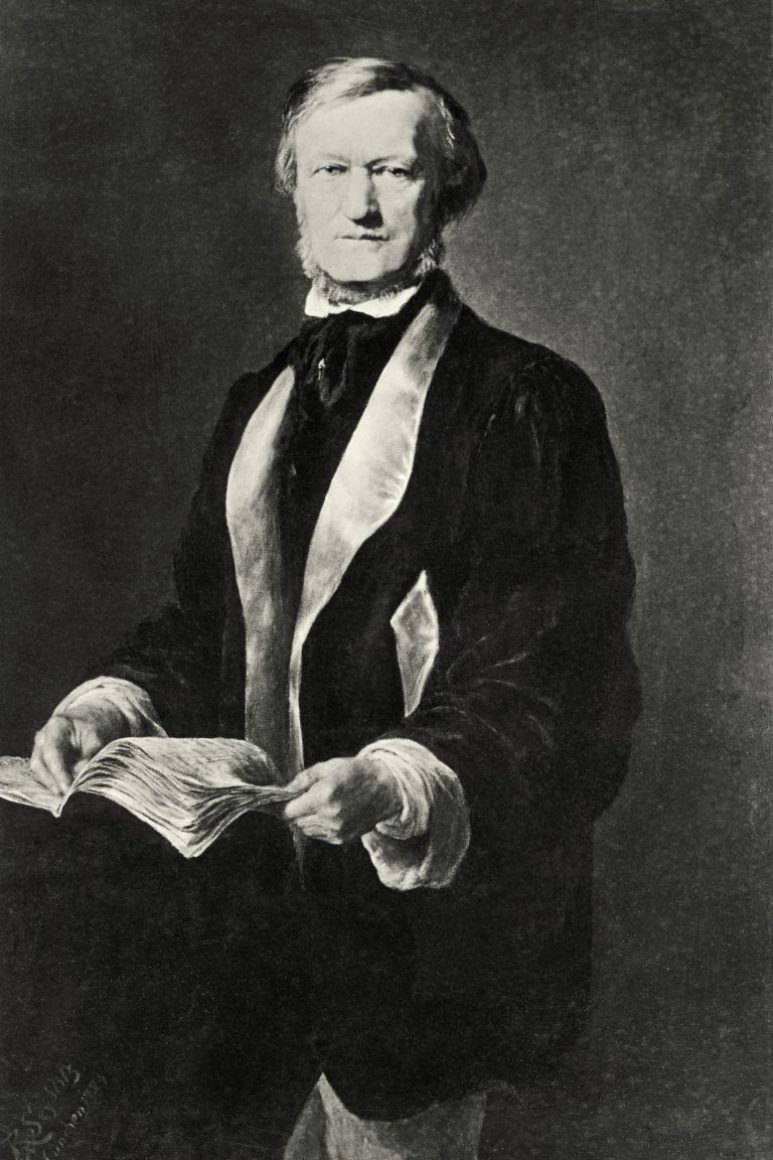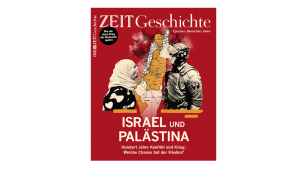Was für eine Aussicht! Atemberaubend der Blick auf den Vierwaldstättersee und die Alpen: Ein Ort, ja ein Schauplatz, der sich bei Gewitter in eine mystische Landschaft verwandelt. Es ist, als ob sich der Betrachter in ein bildhaftes Hören hineinsteigern könnte. Berauschende Musik. Musik als Rausch. Musikdrama. Von 1866 bis 1872 befand sich hier, im Tribschener Landhaus, Richard Wagners Wohnstätte.
In der Tat verband sich der Aufenthalt des Komponisten an diesem besonderen Ort auf einer kleinen Landzunge im See mit musikalischer Produktivität. In den Augen seiner Verehrer: mit musikalischer Genialität. So vollendete er hier, wo sich heute das Richard‑Wagner‑Museum Luzern befindet, Die Meistersinger von Nürnberg und Siegfried, zudem schrieb er an seiner Götterdämmerung. Die geweckten Elementargeister mögen Schöpfungskräfte freigesetzt und zu einer vermeintlichen Genieästhetik beigetragen haben – gleichzeitig überarbeitete Wagner in dieser Zeit seine 1850 unter dem Pseudonym K. Freigedank erschienene Schrift Das Judenthum in der Musik. 1869 erschien nun im eigenen Namen seine Zweitfassung, die durch ein ausführliches Vor- und Nachwort erweitert wurde.
Inwiefern die Inszenierung des Freidenkers einem abstrusen Querdenker entspricht, macht nun eine Sonderausstellung in Luzern deutlich, die unter anderem der Genese dieser Schrift gewidmet ist. Dass Wagner in Paris nicht Fuß fassen konnte und musikalisch scheiterte, begründete er mit dem schlechten Geschmack eines Publikums, das ausgerechnet am jüdischen Komponisten Giacomo Meyerbeer Gefallen fand. Als Rückkehrer nach Dresden schlug seine Enttäuschung in Hass um, wobei die Negativerfahrungen in Paris sich verschwörungstheoretisch zu einem antijüdischen Reflex steigerten.
Wagner scheiterte in Paris. Er glaubte, das Publikum bevorzuge jüdische Musiker.
So schreibt er von einer »Verjüdung der modernen Kunst«. Jüdinnen und Juden, die keinen eigenen Staat hätten, seien überall als »Ausländer« beheimatet und eigneten sich jede Sprache als Fremdsprache an. Somit könnten sie »nicht wirklich redend dichten oder Kunstwerke schaffen«. Nur eine vollständige Assimilation oder das Ablegen der jüdischen Identität könne als »wiedergebärendes Erlösungswerk« das Unheil abwenden.
Der jüdische Komponist Rubinstein bat Wagner um Hilfe
Der in der Ausstellung porträtierte russische Pianist Joseph Rubinstein legt davon tragisches Zeugnis ab und gewährt einen Einblick in Wagners hochambivalentes Verhältnis Juden gegenüber. In einem Brief bittet er – als Jude – Wagner 1872 um Hilfe. Der lud ihn kurz vor seinem Wegzug aus Tribschen tatsächlich ein. Von da an blieb Rubinstein in Wagners Nähe und wurde auch mit musikalischen Aufträgen betraut. So fertigte er eine Kopie der Götterdämmerung sowie Klavierauszüge von Parsifal an und wurde durch seine Dienste in Bayreuth unverzichtbar.
Folgende Passage aus dem erwähnten Brief schafft indes einen schauerlichen Echoraum auf Wagners Schrift: »Ich versuchte eine dramatische Komposition, in der vielleicht Ihr Einfluss wiedererkannt werden könnte. Aber sie befriedigte mich nicht. Mein Zustand wird immer schlimmer, denn ich erkenne, dass die Juden untergehen müssen; wie sollte ich aber nicht untergehen, da ich selbst Jude bin? Durch die Taufe kann ich nicht untergehen: Mir bliebe nur noch der Tod! Schon habe ich versucht, ihn mir zu geben: aber noch beschloss ich, Ihnen zu schreiben. Sie können mir vielleicht noch helfen.«
Dass Joseph Rubinstein ein Jahr nach Wagners Tod 1884 nach Tribschen reiste und sich am Seeufer erschoss, mag vordergründig auf psychische Probleme hinweisen. Hintergründig verkörpert diese Tragödie indes nicht nur das prinzipielle Scheitern deutsch-jüdischer Symbiose im Prozess der Assimilation und Akkulturation, sondern darüber hinaus deutet sich eine Bruchlinie innerhalb des religiös motivierten Antisemitismus an: Die Taufe erlöst nicht (mehr).
Antijüdische Reflexe und politischer Antisemitismus
Ein erweiterter Blick in Wagners Zweitfassung vergegenwärtigt die gedanklichen Abgründe entlang der entstandenen Bruchlinie. Denn über den judenfeindlichen Allgemeinplatz des Parasitären hinaus verschärft Wagner in seinem selbst gewählten Tribschener Exil den antijüdischen Reflex hin zu einem politischen Antisemitismus.
In der darin angelegten völkischen Ideologie versagt das staatsbürgerliche Modell absoluter Assimilation, da sich in der gesteigerten Form der Paranoia das Fremde des Jüdischen per se nicht an die deutsche Leitkultur angleichen kann. Was hier in krasser Form identitäre Politik vorwegnimmt und gleichzeitig vorbereitet, zielt auf den jüdischen Menschen als Fremdkörper ab. So führt Wagner in der Zweitfassung aus: »Ob der Verfall unserer Cultur durch eine gewaltsame Auswerfung des zersetzenden, fremden Elementes aufgehalten werden könne, vermag ich nicht zu beurteilen, weil hierzu Kräfte gehören müßten, deren Vorhandensein mir unbekannt ist.«
Die »gewaltsame Auswerfung« steht im Kontext radikaler Eliminierung und lässt sich wörtlich auf Auswurf beziehen. Das Aus- und Absondern eines schleimigen Sekretes schafft untergründig ekelerregende Assoziationen, welche die NS-Propaganda gezielt zur Dehumanisierung jüdischer Menschen einsetzen wird.
Spur der Vernichtung
Auch wenn Wagner nicht explizit Juden mit Ratten oder Krankheitserregern gleichsetzt, nistet sich durch sein Denken im kollektiven Gedächtnis die Spur der Vernichtung ein. Umso größer ist das durch die Ausstellung ausgelöste Erstaunen über Theodor Herzls Wagner-Begeisterung, der im Zuge seiner Niederschrift Der Judenstaat in Paris mehrmals Wagners Tannhäuser besuchte.
Der israelische Historiker und Soziologe Moshe Zuckermann, der 2020 mit Wagner. Ein ewig deutsches Ärgernis einen anregenden Essay vorgelegt hat, wuchs als Sohn polnisch-jüdischer Holocaust-Überlebender in Tel Aviv auf und kennt selbstredend das Tabu, in Israel Wagner öffentlich aufzuführen. Die Ausstellung endet mit Stellungnahmen jüdischer Persönlichkeiten zum »Tabu Wagner«. Zuckermann ist eine der Stimmen, die dafür einstehen, zwischen dem Werk und der Person Wagner zu differenzieren.
So warnt er davor, die Rezeptionsgeschichte beziehungsweise die Vereinnahmung Wagners durch das NS-Regime auf das Werk und auf die Person zurückzuführen. In seinem Essay führt er natürlich Wagners Antisemitismus aus, würdigt den Komponisten aber in einem Kapitel gleichzeitig als revolutionären Tondichter. Um neue Werkformen zu schaffen, strebte Wagner die vollendete Integration von Musik ins Drama an. Dies fand seinen Höhepunkt in der Programmmusik und verdichtete sich in der Essenz des berühmten »Leitmotivs«. Dieses trage aber nicht bloß zur Dramatisierung der Musik bei, sondern führe zur psychischen Erregung.
Dies fügt sich in Wagners Konzept des Bühnenwerks als »Gesamtkunstwerk« ein – verstärkt durch den in Bayreuth in Szene gesetzten Effekt, dass das Orchester unter der Bühne versinkt. Zuckermann weiß um die Ambivalenz einer so gearteten Ästhetik: »Die dramatische Vorgabe bewirkt in dieser Weise ein rein musikalisches Ergebnis, das seine Logik gleichwohl Außermusikalischem verdankt.« Die Amalgamierung von Musik und Weltanschauung apostrophiert Zuckermann mit dem vielsagenden Ausdruck der »Vision des totalen Theaters«.
»Wie sollte ich aber nicht untergehen, wenn ich selbst Jude bin?«
Joseph Rubinstein an Wagner
Auch wenn eine strikte Trennung von Werk und Person geboten ist, lässt sich die Vermischung von politischem Programm und Musik nicht übersehen – eine Vermischung, mit der etwa Hitler die Reichsparteitage der NSDAP inszenierte. Dass ausgerechnet in Nürnberg Wagners komische Oper Die Meistersinger von Nürnberg aufgeführt wurde, dürfte mit der genannten außermusikalischen Logik im Zusammenhang stehen.
So erscheinen die Schlusszeilen daraus vollkommen »logisch« – und wenig komisch: »Ehrt eure deutschen Meister, dann bannt ihr gute Geister! Und gebt ihr ihrem Wirken Gunst, zerging in Dunst das heil’ge röm’sche Reich, uns bliebe gleich die heil’ge deutsche Kunst!«
Für Nietzsche war Wagner ein Krankheitsfall
Diese Worte sind nicht explizit antisemitisch, aber zwischen den Zeilen lauert die jüdische Bedrohung, das der deutschen Kunst und Kultur Eigene zu entheiligen. Weshalb es einer »gewaltsamen Auswerfung« bedürfe. So war für Nietzsche Der Fall Wagner vor allem eines: ein Krankheitsfall. In schärfster Polemik bezichtigte er ihn der Dekadenz, indem dieser als Verführer mit den drei Stimulantien des Brutalen, des Künstlichen und des Unschuldigen operiere. Nietzsche pointiert die Notwendigkeit dieser Mittel dahingehend, den Erschöpften zu stimulieren.
Dass er Heinrich Heine zugetan war, dürfte unter anderem genau damit zusammenhängen, dass dieser solcher Mittel nicht bedurfte. Seine Medizin und Kunst bestand in der Ironie – nicht zuletzt als Heilmittel gegen allzu viel romantische Innerlichkeit, die sich erschöpft hat.
Die Neuinszenierung der Meistersinger von Nürnberg bei den Festspielen in Bayreuth unter der Regie von Matthias Davids bestätigt diesen Ansatz. Der ausgewiesene Musical-Experte nähert sich mit Humor und Witz dem Stück. Dies ist ganz im Sinne von Heine, um Wagners Humorlosigkeit zu konterkarieren – und mithin ein Tabu aufzubrechen, was der interessanten Ausstellung »Tabu Wagner? Jüdische Perspektiven« auf alle Fälle gelingt.
Die Sonderausstellung »Tabu Wagner? Jüdische Perspektiven« ist noch bis Ende November im Richard-Wagner-Museum Luzern zu sehen.