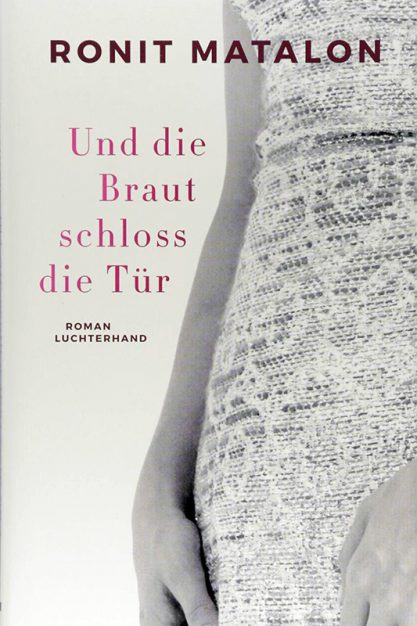Sie wurde nur 58 Jahre alt: Ronit Matalon, Schriftstellerin, Journalistin und Professorin für hebräische und vergleichende Literatur an der Universität Haifa, ist am 28. Dezember 2017 an Krebs gestorben.
Einen Tag vor ihrem Tod wurde die Israelin für ihren kurzen Roman Und die Braut schloss die Tür mit dem Brenner-Preis der Hebrew Writers Association in Israel ausgezeichnet. Stellvertretend für ihre Mutter nahm Ronit Matalons Tochter Talya den Preis am 27. Dezember entgegen. Sie trug auch die Dankesrede der Autorin vor, in der Ronit Matalon Parallelen zur Handlung ihres Buchs zog: »Abwesenheit ist manchmal genauso bedeutsam wie Anwesenheit.«
In Und die Braut schloss die Tür schließt sich Margalit, genannt Margi, eine junge Frau aus einer sefardisch-jüdischen Familie in Israel, wenige Stunden vor der geplanten Hochzeit im Schlafzimmer ihres Elternhauses ein und weigert sich hartnäckig, wieder herauszukommen: »Ich heirate nicht, heirate nicht, heirate nicht!«
Festgarten Mit ihrer unerwarteten Haltung stellt die Heldin die gesamte Familie auf eine schwere Probe. Denn der Festgarten ist bestellt, wie in Israel üblich sind Hunderte von Gästen eingeladen, doch Margi verweigert die Mitwirkung an der von ihr selbst initiierten Heirat mit ihrem Bräutigam Matti – und das völlig ohne Erklärung.
Ronit Matalon zeigt in ihrem kurzen Buch, das mit seinen begrenzten Schauplätzen – die Wohnung der Brautmutter, ein Parkplatz, ein Auto – ein wenig an einen Low-Budget-Film erinnert, wie die Weigerung der Braut eine Familientragödie weitaus größeren Ausmaßes zum Vorschein bringt: Margis kleine Schwester Nathalie ist vor zehn Jahren spurlos verschwunden, der Vater hat sich fünf Jahre später von der Mutter getrennt.
Was Margis Weigerung zu heiraten mit dieser Vorgeschichte zu tun haben könnte, oder ob der Grund in ihrer Beziehung zu Matti zu suchen ist, bleibt offen. Genau das ist der Reiz an diesem Buch, das auch durch seine präzise Sprache besticht. Wie der brüskierte Bräutigam, seine Eltern und die Brautmutter fragt sich auch die Leserin während der gesamten Lektüre: Warum tut sie das – ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt?
Psychiaterin Doch weder Matti noch die herbeigerufene, privat praktizierende Psychiaterin von der Organisation »Bereuende Bräute«, die für solche Situationen geschult ist und für Noteinsätze massiv zur Kasse bittet, bringen Margi dazu, sich zu erklären.
Der Angestellte der Palästinensischen Autonomiebehörde, ein Bekannter der Familie, der ein Auto mit Leiter besitzt und über das Fenster des Hauses einen Zugang zum Schlafzimmer schaffen soll, können ebenfalls nichts ausrichten. Schließlich ist es Sabtuna, die nur auf den ersten Blick beschränkte Großmutter, die erfolgreich an die Gefühle der Braut appelliert – mit einem Lied der arabischen Sängerin Fairuz.
Darin liegt viel Symbolik: Ronit Matalon, die immer wieder die Probleme von »Misrachim« thematisierte, als Reporterin für »Haaretz« arbeitete und aus den palästinensischen Gebieten berichtete, gilt als wichtige literarische Stimme »arabischer« Juden.
Ihre Eltern wanderten aus Ägypten nach Israel ein; Ronit Matalon wuchs größtenteils bei ihrer Großmutter auf. In Deutschland sind bisher Was die Bilder nicht erzählen (1998), Eine Geschichte, die mit dem Begräbnis einer Schlange beginnt (1999) und Sara, Sara (2000) erschienen. Nun, da Ronit Matalons letztes Buch auf Deutsch publiziert wird, fühlt man sich an ein Sprichwort erinnert: Eine Tür öffnet sich, wenn eine andere sich schließt.
Ronit Matalon: »Und die Braut schloss die Tür«. Aus dem Hebräischen von Gundula Schiffer. Luchterhand, München 2018, 160 S., 18 €