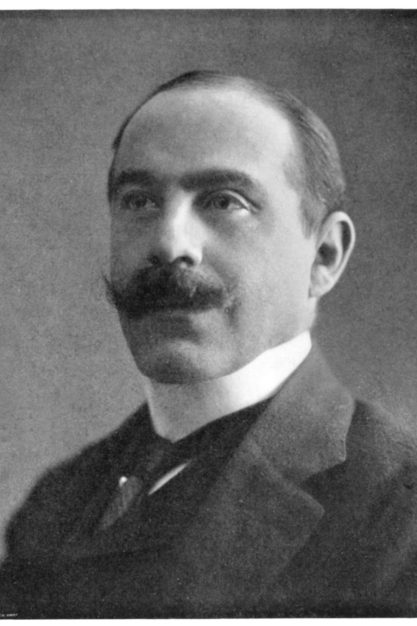Der Verlust war wohl gewaltig. Diesen Eindruck vermitteln die unzähligen Nachrufe, die unmittelbar nach dem Tod von August von Wassermann am 16. März 1925 erschienen und das plötzliche Ableben des renommierten Wissenschaftlers im Alter von gerade einmal 59 Jahren beklagten. So schrieb der Stellvertreter des Reichspräsidenten – Friedrich Ebert war zwei Wochen zuvor an einem Blinddarmdurchbruch gestorben – der Witwe: »Das Reich und Preußen verlieren in der Fürsorge für die Volksgesundheit durch seinen Tod einen verständnisvollen Mitarbeiter und einen tatkräftigen Förderer.«
Berühmt geworden war Wassermann durch das von ihm 1906 erstmals veröffentlichte Verfahren zum Nachweis der Syphilis, einer damals weit verbreiteten und gefürchteten Geschlechtskrankheit. Überall auf der Welt setzte sich in den Jahrzehnten danach der sogenannte »Wassermann-Test« in den Untersuchungslabors durch.
Drei Tage nach seinem Tod fand auf dem Urnenfriedhof im Berliner Stadtteil Wedding in Anwesenheit von viel Prominenz aus Medizin und Gesellschaft die Beisetzung statt. Rabbiner Leo Baeck hielt die Trauerrede. Wassermann hatte in den Jahren zuvor als Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Akademie für die Wissenschaft des Judentums amtiert. Für die 1919 gegründete freie Forschungsstätte mit dem Schwerpunkt jüdische Studien engagierte sich neben seinem Cousin Oscar Wassermann, von 1923 bis 1933 Vorstandssprecher der Deutschen Bank, auch Albert Einstein.
Bamberger Bankiersfamilie
August von Wassermann selbst stammte aus einer Bamberger Bankiersfamilie. Vater und Onkel hatten das Bankgeschäft A. E. Wassermann aufgebaut. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts unterhielt es neben seinem oberfränkischen Stammsitz Niederlassungen in Berlin, London, Wien und Brüssel. 1910 war der Vater von August sogar in den bayerischen Erbadel erhoben worden, weshalb sich seine Söhne fortan auch »von Wassermann« nennen durften.
Anders als seine beiden Brüder und mehrere Cousins entschied sich August von Wassermann jedoch gegen eine Zukunft im Bankgeschäft. Nach seinem Medizinstudium an den Universitäten Erlangen und Straßburg kam er 1890 als junger Arzt nach Berlin.
Mit etwas Glück erhielt er eine Praktikantenstelle an dem von Robert Koch geleiteten Hygiene-Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität. Als im Jahr darauf für Koch das Königlich Preußische Institut für Infektionskrankheiten gegründet wurde, konnte Wassermann als Volontärassistent mit an die neue Einrichtung wechseln.
Mehr als 20 Jahre forschte er an diesem Vorläufer des heutigen Robert-Koch-Instituts (RKI), länger als jeder andere Wissenschaftler aus der Gründergeneration. An der Seite namhafter Wissenschaftler wie Paul Ehrlich – der ihm den lateinischen Spitznamen »Aquaticus« verlieh – widmete er sich bakteriologischen Fragestellungen und versuchte, die Funktionsweise der Immunabwehr von Menschen zu entschlüsseln.
Verfahren zur Syphilisdiagnostik und forensische Medizin
Neben dem bahnbrechenden Verfahren zur Syphilisdiagnostik machte er sich auf dem Gebiet der forensischen Medizin einen Namen. Zusammen mit seinem Mitarbeiter Albert Schütze entwickelte er eine serologische Methode zur Unterscheidung von Menschen- und Tierblut, die fortan bei Gerichtsverfahren mit »blutigen« Beweisstücken zum Einsatz kam. Dass diese Innovation unter dem Namen »Uhlenhuth-Probe« in die Medizingeschichte eingegangen ist, liegt daran, dass der Greifswalder Bakteriologe Paul Uhlenhuth unabhängig von Wassermann und Schütze ein ganz ähnliches Verfahren entwickelt und einen Tag vor seinen Berliner Kollegen veröffentlicht hatte.
Mit einer Chemotherapie brachte Wassermann Tumore bei Mäusen zum Schrumpfen.
Große Aufmerksamkeit erlangte Wassermann auch als Pionier der Chemotherapie. So konnte er 1911 mittels einer Kombination der Substanzen Eosin und Selen Tumore bei Mäusen zum Schrumpfen bringen. Zwar warnte Wassermann explizit davor, vergleichbare Heilerfolge bei menschlichen Krebspatienten zu erwarten. Die Presse, allen voran die »New York Times«, berichtete dennoch euphorisch. Tatsächlich ließen sich die Ergebnisse in der Folge nicht auf den Menschen übertragen – trotzdem gelten sie als Meilenstein auf dem Weg zur modernen Krebstherapie.
1913 wurde August von Wassermann die Leitung des neu gegründeten Kaiser-Wilhelm-Instituts (KWI) für experimentelle Therapie übertragen. Zur Einweihung erschien Kaiser Wilhelm II. persönlich. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) zur Förderung der Wissenschaften – Vorläufer der heutigen Max-Planck-Gesellschaft – war bereits 1911 gegründet worden. Der Berliner Theologieprofessor und Kaiserberater Adolf Harnack hatte in einer Denkschrift den Reformbedarf des deutschen Wissenschaftssystems angemahnt und die Einrichtung unabhängiger, auf Grundlagenforschung ausgerichteter Forschungsinstitute empfohlen, wobei die Naturwissenschaften im Fokus stehen sollten.
In die Planung und Gestaltung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für experimentelle Therapie flossen auch zahlreiche Ideen von Wassermann ein. Und das Konzept, ein außeruniversitäres Forschungsinstitut um einen renommierten Wissenschaftler herum aufzubauen und dieser Persönlichkeit weitreichende Gestaltungsfreiheiten einzuräumen, sollte sich bei der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als Erfolgsrezept durchsetzen.
Wirksamkeit von Impfungen gegen Typhus und Cholera
Doch der Erste Weltkrieg lenkte die Forschungspläne Wassermanns erst einmal in andere Bahnen. Nun ging es darum, die Wirksamkeit von Impfungen gegen Typhus und Cholera zu überprüfen, mit denen deutsche Soldaten vor den gefürchteten Seuchen geschützt werden sollten. Wassermann selbst wurde als Militärhygieniker mit der Überwachung der Infektionskrankheiten an der Ostfront betraut. Vor Militärärzten hielt er Vorträge zum Thema »Seuchenbekämpfung im Kriege«. Später wurde er zum Leiter des Amts für Hygiene und Bakteriologie im preußischen Kriegsministerium berufen. Nach dem Krieg nahm das von Wassermann geleitete KWI seine zivilen Forschungstätigkeiten wieder auf.
Dass August von Wassermann heute sowohl in der medizinischen Fachwelt als auch in der deutschen Öffentlichkeit nahezu unbekannt ist, hat vermutlich mehrere Ursachen. Ein Grund dürfte sein, dass der Mediziner – obwohl er 45 Mal nominiert wurde – nie einen Nobelpreis für seine Forschungen erhalten hat. Ein weiterer ist sicherlich, dass sich die Medizin seit damals rasant weiterentwickelt hat: Heute wird der Wassermann-Test bei der Syphilisdiagnostik nicht mehr verwendet, da modernere und bessere Nachweisverfahren zur Verfügung stehen.
Es gibt aber wohl einen dritten Grund: August von Wassermann war Jude. Die Erinnerung an jüdische Persönlichkeiten – egal ob Künstler, Unternehmer oder Forscher – wurde im Nationalsozialismus gezielt bekämpft. Auch seine Familie musste unter Verfolgungen leiden, viele Angehörige gingen ins Exil, seine Witwe wurde 1943 in Auschwitz ermordet.
Fünf Jahre nach Wassermanns Tod wurde in unmittelbarer Nähe des von ihm einst geleiteten KWI für experimentelle Therapie in Berlin-Dahlem ein noch namenloser Platz nach dem berühmten Forscher benannt. Die Nationalsozialisten ließen 1938 jedoch alle nach jüdischen Persönlichkeiten benannten Straßen und Plätze in Berlin umbenennen. Aus dem Wassermannplatz wurde der bis heute dem Botaniker und Genetiker Carl Correns gewidmete Corrensplatz.
Statt Rückbenennung Einrichtung einer Art Ausgleichsfläche
Die Bezirksverordnetenversammlung des Bezirks Steglitz-Zehlendorf entschied sich Jahrzehnte nach Kriegsende statt einer Rückbenennung für die Einrichtung einer Art Ausgleichsfläche. 2022 wurde der »neue« August-von-Wassermann-Platz, nur fünf Minuten Fußweg vom alten entfernt, gegenüber dem Harnack-Haus, der Tagungsstätte der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, eingeweiht.
Wer sich heute in Berlin auf die Spuren von August von Wassermann begeben möchte, kann neben dem RKI und dem ehemaligen KWI für experimentelle Therapie sowie dem August-von-Wassermann-Platz und einer in Adlershof nach ihm benannten Straße auch seine letzte Ruhestätte aufsuchen, die als Ehrengrab des Landes Berlin ausgewiesen ist. Wassermanns Urne befindet sich im Columbarium auf dem Urnenfriedhof Wedding in der Gerichtstraße.
Der Autor ist Leiter des Museums im Robert-Koch-Institut.
Zum Todestag bietet die Max-Planck-Gesellschaft am 16. März eine wissenschaftshistorische Führung zu den jüdischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf dem Campus Dahlem mit einem besonderen Schwerpunkt auf August von Wassermann an.