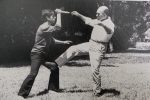Die slowakische Kulturministerin Martina Šimkovičová lässt aus nicht näher genannten Gründen landesweit Museen und andere Kultureinrichtungen schließen. Die rechtspopulistische Politikerin wird immer wieder dafür kritisiert, dass sie Mitglieder der Kulturszene schikaniert und Hass gegenüber Minderheiten zum Ausdruck bringt. Ihrer Meinung nach ist »die Kultur des slowakischen Volkes slowakisch, nur slowakisch, und nichts anderes«. Fast wäre ihr auch das Jüdische Museum in der ostslowakischen Stadt Prešov zum Opfer gefallen.
Die Stadtverwaltung zeigte sich über den Schließungswunsch sehr verwundert, da es sich mit etwa 4000 Besuchern im Jahr um eines der beliebtesten Museen in Prešov handelt, das mit minimalen Ausgaben betrieben wird. Der jährliche staatliche Zuschuss betrage nicht einmal 10.000 Euro.
Verhandlungen mit dem Betreiber des Museums
Nach Verhandlungen mit dem Betreiber des Museums, dem Nationalmuseum und der jüdischen Gemeinde der Stadt, entschloss sich Bürgermeister František Olʼha kurzerhand, diesen Betrag zur Verfügung zu stellen, um die Ausstellung vor dem Ende zu bewahren. Dies teilte er auf einer Pressekonferenz vor der im vergangenen Jahr aufwendig renovierten orthodoxen Synagoge mit. Sein neues Geschäftsmodell umfasst die Neugestaltung des Jüdischen Museums, den Ankauf der Vitrinen, die derzeit dem Nationalmuseum gehören, und unentgeltliche Führungen. Er hoffe, dass sich die EU in Zukunft an den Ausgaben beteiligen werde, so Olʼha.
Die grandiose Synagoge aus dem spätern 19. Jahrhundert, in deren Galerie sich das Museum befindet, beherbergt die sogenannte Bárkány-Kollektion. Die ist mit mehreren Tausend Exponaten eine der wichtigsten Judaica-Sammlungen in Mittelosteuropa. Eugen Bárkány war Unternehmer und Bauingenieur und leidenschaftlicher Sammler. Er gründete 1928 das Museum. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Ausstellung geschlossen und später von der kommunistischen Regierung nicht wiedereröffnet.
Wie durch ein Wunder ist der größte Teil der Exponate erhalten geblieben, wurde 1953 nach Prag gebracht und ausgestellt. Nach der Auflösung der Tschechoslowakei im Jahr 1993 wurde die Ausstellung über das Slowakische Nationalmuseum an die jüdische Gemeinde von Prešov zurückgegeben. Das Bethaus, in dem regelmäßig Gottesdienste abgehalten werden, ist Eigentum der Gemeinde.
Moralische Pflicht
»Die jüdische Bevölkerung war immer ein Bestandteil unserer Stadt, und es ist uns wichtig, diese Geschichte gewissenhaft zu bewahren und an künftige Generationen weiterzugeben«, sagte Olʼha gegenüber dieser Zeitung. Prešov habe der jüdischen Gemeinde während des Zweiten Weltkriegs, als die Deportationen stattfanden, großes Leid zugefügt. Auch das sei Teil der Stadtgeschichte, vor dem man nicht die Augen verschließen dürfe, so der Bürgermeister.
Es sei nun die moralische Pflicht der Stadt, ihre historischen Überlieferungen als wichtige Quelle der Erinnerung an das lokale Judentum zu bewahren und zu präsentieren. Und nicht zuletzt gehe es auch darum, die Stadt touristisch attraktiver zu machen. »Wir würden es als großen Verlust empfinden, wenn wir den Besuchern die bedeutende Bárkány-Sammlung, die zu den wichtigsten der jüdischen Gemeinschaft in Mitteleuropa gehört, nicht präsentieren und die jüdische Geschichte unserer Stadt, die so eng mit Prešov verbunden ist, nicht vermitteln könnten«, fügte er hinzu.
Vor der Schoa lebten in Prešov rund 4300 Juden, die knapp 18 Prozent der Gesamtbevölkerung stellten. Nur sehr wenige haben überlebt. František Olʼha schätzt die Zahl der jüdischen Einwohner heute auf 100 bis 200.