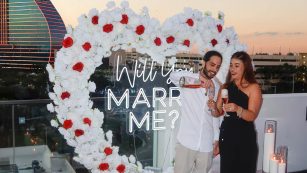Bereits nach ungefähr zwei Dritteln der Sendung am Donnerstagabend zog Markus Lanz ungewollt das Resümee. »Wenn Sie das für glasklar halten, dann will ich nicht erleben, wenn Sie wirklich mal was Glasklares sagen müssen«, schleuderte der Talkshow-Moderator seinem Studiogast Thorsten Frei (CDU) entgegen.
Es war das Eingeständnis, dass der rhetorisch versierte Kanzleramtschef ungefähr so schwer auf eine verbindliche Aussage festzunageln ist wie Pudding an der Wand.
Hinzu kommt: Frei hat Erfahrung gesammelt in derlei TV-Sendungen. In den vergangenen Monaten kam dem CDU-Politiker schon mehrfach die Aufgabe zu, die abrupten politischen Volten seines Chefs einer perplexen deutschen Öffentlichkeit zu erklären, ohne dabei den Eindruck zu vermitteln, seine Partei habe schamlos ihre Wahlversprechen einkassiert.
Lanz versuchte tapfer, Frei bei den Themen Wehrdienst, Rentenreform, Sozialabbau und Steuererhöhungen zu stellen. Gelegentlich tat er es im Verein mit seinen beiden anderen Gästen, der »taz«-Wirtschaftsredakteurin Ulrike Herrmann und dem Chefredakteur der »Welt«-Gruppe, Jan-Philipp Burgard, der erstmals Studioluft bei Lanz schnupperte. Schnippisch bemerkte Herrmann, Frei sei angesichts seines Talents, sich nicht festlegen zu lassen, »nicht umsonst Kanzleramtsminister« geworden.
»Krasse Kehrtwende«
Auch im Hinblick auf den von Merz vor drei Wochen verkündeten teilweisen Lieferstopp für deutsche Rüstungsgüter, die von Israel im Gazastreifen eingesetzt werden können (für Burgard eine »krasse Kehrtwende« und ein Bruch mit der Staatsräson), versuchte der Jurist Frei den Eindruck zu zerstreuen, man sei umgefallen. Zuvor hatte Lanz ihn noch gefragt: »Was ist da bei Ihnen im Kanzleramt abgelaufen? Das war ja offensichtlich eine sehr einsame Entscheidung. Die CSU war nicht informiert.«
Schon das Wort »Kehrtwende« ließ Frei nicht gelten. »Friedrich Merz hat unmittelbar danach gesagt, dass die Grundlinien der Israelpolitik nicht verändert werden«, verteidigte er die einsame Entscheidung des Bundeskanzlers tapfer. Außerdem könne man ja wegen der Geheimhaltungspflichten im Bundessicherheitsrat nicht richtig darüber reden, fügte Frei hinzu.
Burgard hielt ungläubig fest, dass innerhalb der Union die Entscheidung von vielen durchaus als Kehrtwende und Wortbruch aufgefasst und diese ja auch öffentlich begründet worden sei, was man sich hätte sparen können. An der CDU-Basis gebe es geradezu Aufstände und »Leute, die sagen, sie kleben in Zukunft keine Plakate mehr für Friedrich Merz, weil er Israel verraten hat«, so der »Welt«-Chefredakteur.
Thorsten Frei gab zu, was nicht zu leugnen war, mehr aber auch nicht. Kritik habe es durchaus gegeben, aber keine scharfe Rhetorik, wie von Burgard und Lanz festgehalten. »Natürlich gibt es auch in der eigenen Partei diejenigen, die Entscheidungen gut finden und andere weniger gut«, sagte Frei. Aber »die Rhetorik«, die habe er so nicht vernommen, fügte er an, um dann erneut die Entscheidung des Kanzlers zu erklären.
»Hat mit Innenpolitik nichts zu tun«
Es gebe gar keine Änderungen in den Grundlinien der deutschen Israelpolitik, behauptete Frei. »Es ist auch nicht so, dass es keine Waffenlieferungen an Israel gibt. Es ist völlig klar, dass überall dort, wo sich Israel in einer sehr, sehr feindlichen Umgebung – Sie haben vorher den Iran angesprochen – verteidigen muss. Wenn es um Luftverteidigung geht, um Seeverteidigung, dann liefern wir selbstverständlich, so wie das in der Vergangenheit auch der Fall war. Und jetzt haben wir eine spezifische Situation in Gaza.«
Burgard, der auch hier argumentativ immer wieder punkten konnte, versuchte nachzufassen. Merz habe doch in seiner Rede im Bundestag vor ein paar Monaten deutlich gemacht: »Man muss Israel helfen, sich selber zu verteidigen, auch wenn das mit gewissen Härten einhergeht. Man muss Israel geben, was es braucht.« Jetzt weiche der Kanzler von dieser Linie ab, mutmaßlich aus innenpolitischen Gründen.
Doch das bestritt Frei energisch. Der vorläufige Stopp der Rüstungsexporte habe mit Innenpolitik absolut gar nichts zu tun, beteuerte er. Dabei hatte die Bundesregierung selbst die Entscheidung auch mit dem inneren Frieden in Deutschland begründet. Und man müsse schließlich auch die Stimmung in anderen europäischen Ländern zur Kenntnis nehmen, wo nachdrücklich Sanktionen gegen Israel gefordert würden. Israel habe keinen größeren Freund in Europa als Deutschland, behauptete er.
Man habe sich »immer gegen Sanktionsforderungen« seitens europäischer Partner gestellt, so der Kanzleramtschef. Auch das war nicht ganz korrekt, denn vor vier Wochen hatte Merz sich die Möglichkeit, dass Deutschland dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Ausschluss israelischer Unternehmen aus einem Förderprogramm zustimmen könnte, ausdrücklich offen gehalten. Doch das war vor dem Waffenembargo, und es erscheint wahrscheinlich, dass eine deutsche Zustimmung zu Sanktionen auf EU-Ebene die Union vor eine noch größere Zerreißprobe stellen würde.
Die Freundschaft mit Israel sei ja nach wie vor unverbrüchlich, betonte Frei. Es gebe einen »ganz engen Austausch« auf Regierungsebene; Merz habe in den letzten Wochen »vielfach mit Netanjahu telefoniert« und sich zweimal mit dem israelischen Premier getroffen. Mit anderen Worten: Wenigstens reden die Partner noch miteinander. Aber wenn man sich »die praktische Politik der vergangenen Tage und Wochen« anschaue, dann sei »da eben eine Entwicklung« gewesen, mäanderte Frei munter weiter.
Ja, die Herrschaft der Hamas müsse beendet werden, darin gab er Burgard Recht. Aber warum das ohne deutsche Waffen geschehen müsse, erläuterte er nicht.
Journalistin stellt Hamas und Netanjahu-Regierung auf eine Stufe
Während die Entwicklung der deutschen Nahostpolitik für Jan-Philipp Burgard schon jetzt komplett in die falsche Richtung geht, ist sie der taz-Journalistin Ulrike Herrmann nicht klar genug. Nicht nur die Hamas müsse »ausgeschaltet« werden, forderte sie, sondern »auch dieses rechtsradikale Regime in Israel«, die Netanjahu-Regierung, »damit sie da nicht mehr an der Macht sind und nicht weiter in Gaza etwas betreiben, was einige Genozid nennen«, so Herrmann.
Etwas ungläubig ging Markus Lanz dazwischen. Ob sie denn wirklich von »ausschalten« gesprochen habe, fragte er die taz-Journalistin. Die war jetzt auf Betriebstemperatur. Eine Annexion des Westjordanlandes durch Israel stehe kurz bevor, meinte sie, und deshalb müsse auch Deutschland nun einen Staat Palästina anerkennen, denn, so Herrmann: »Israel unterminiert im Augenblick mit seiner rechtsradikalen Regierung jede Art von Frieden. Und wenn man da Frieden will, dann muss man eben Druck auf Netanjahu ausüben und Druck auf die Hamas ausüben.« Die arabischen Staaten hätten das gemacht.
Ungeniert stellte Herrmann die Hamas und Israels Regierung auf eine Stufe. »Wir im Westen müssen aber auch Druck auf Netanjahu ausüben, damit da diese beiden, die sich immer gegenseitig untereinander gestützt haben, keinen Einfluss haben.« Dann war die Sendezeit abgelaufen.
Viel Klarheit brachte »Markus Lanz« am Donnerstag nicht, und auch der Unterhaltungsfaktor war schon mal größer. Das dicke Brett des Nahostkonflikts ist noch nicht durchbohrt. Etwas konsterniert stellte der Moderator am Ende fest: »Das Thema wird uns auf jeden Fall nicht das letzte Mal beschäftigt haben. Ich danke Ihnen sehr für den Versuch, zumindest das ein bisschen einzuordnen. Es gehört zum Kompliziertesten, was die deutsche Politik an Aufgaben zu bieten hat.« Dem ist nichts hinzuzufügen.