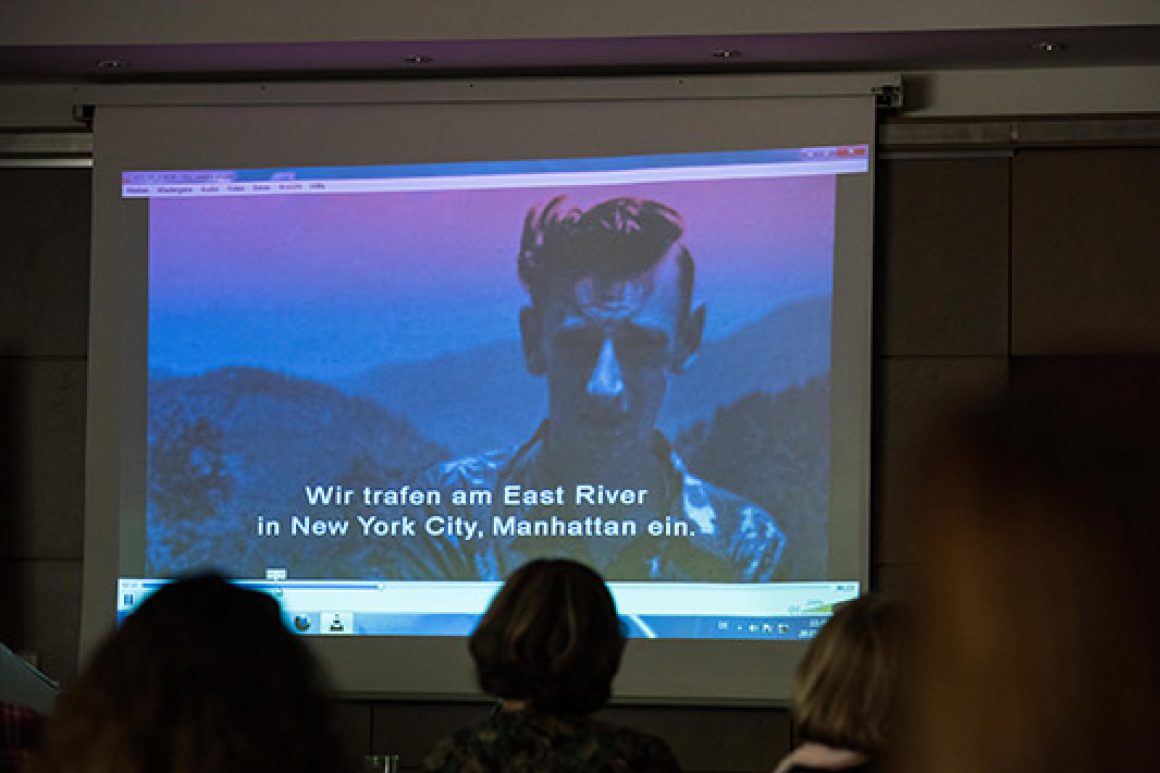Fred Heyman ist ein sehr gesprächiger Mann. Das war der 88-Jährige nicht immer. Noch bis zum Jahr 2000 hatte er seine eigene Lebensgeschichte aus dem Alltag verdrängt. Doch als vor 17 Jahren seine Frau starb, holte ihn die Vergangenheit ein, und er begann immer mehr, über seine Jugend nachzudenken. Vor allem eine Frage stellte er sich wieder und wieder: Wie haben wir das alles überlebt? Seitdem hört Fred Heyman nicht mehr auf, darüber zu reden – über den Holocaust, über seine Heimatstadt Berlin, die ihm fremd wurde, über brennende Synagogen und Hitler-Reden.
Als er Ende Mai in Berlin im Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße sitzt und über seine Erfahrungen berichtet, zieht er die Zuhörerschaft mit seiner sympathischen, herzlichen Art sofort in seinen Bann. Fred Heyman lacht gern und viel, spricht mal Englisch, mal Deutsch. Die Strapazen des mehrstündigen Fluges aus den USA sind ihm nicht anzumerken.
barmizwa Es ist das Filmprojekt Be An Upstander, das ihn über den Atlantik geführt hat – »Sei ein Aufrechter«, eine 30-minütige Dokumentation über ihn, Manfred Heymann, so hieß er einmal, bevor er 1946 mit seinen Eltern in die USA immigrierte.
Der 19-jährige Howard Goldberg hat Fred Heyman vor die Kamera geholt.
Kennengelernt hat er seinen Protagonisten während eines Ausfluges zum United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C., der damals von der Jewish Federation of Greater Metrowest organisiert worden war. Die gemeinnützige Vereinigung hatte Ende der 90er-Jahre ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem junge Juden, die kurz vor ihrer Bar- oder Batmizwa stehen, auf einen Schoa-Überlebenden treffen. Über mehrere Monate kommen beide Generationen zusammen, um sich auszutauschen. So war es auch bei Howard Goldberg und Fred Heyman. Nur dass der junge Howard, damals zwölf Jahre alt, am Ende zu Fred Heyman meinte: »Über dich mache ich einen Film!« Der junge Amerikaner hielt Wort. 2014 holte er Heyman vor die Kamera, 2015 feierte der 30-minütige Film Premiere.
Fred Heyman berichtet darin, wie er während der Schoa zusammen mit seinem jüdischen Vater und seiner nichtjüdischen Mutter in Berlin aufwuchs. Er erzählt, wie Leute ihm zur Seite standen, wie sie ihm in dieser Zeit halfen. Er verbindet seinen Bericht mit der Botschaft, ein »Aufrechter« zu sein, denn seine Geschichte ist eine Geschichte des Bösen, das geschieht, weil die Guten abseits standen und es geschehen ließen. Der pensionierte Elektroingenieur, der heute in den USA lebt, ruft angesichts aktueller Ereignisse dazu auf, sich dessen bewusst zu sein und aktiv zu werden.
erinnerungen Die Erinnerungen purzeln aus Fred Heyman nur so heraus. Er sei am Wittenbergplatz aufgewachsen, erzählt er beim Filmgespräch im Gemeindehaus, ganz in der Nähe des KaDeWe. Für seinen Armeedienst im Ersten Weltkrieg war sein jüdischer Vater mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden. Er, Fred, sei als Junge »aufmüpfig« gewesen, ein Kind mit »Berliner Schnauze« eben.
Eine deutsche katholische Familie hat die Heymanns gerettet, wie auch einzelne andere, die sich gegen das Nazi-Regime gestellt hatten, Menschen, die Fred Heyman als »Aufrechte« bezeichnet. »Sei ein Aufrechter« – das ist sein Motto, das er seit seinem Mitwirken am Jewish-Federation-Projekt ununterbrochen zitiert. »Wir haben heimlich in Berlin gelebt, wie sogenannte U-Boote, aber nicht wie Anne Frank«, sagt der 88-Jährige. »Wir waren in der Öffentlichkeit unterwegs, es wusste aber keiner, dass wir Juden sind.«
An einzelne Momente erinnert er sich genau: an Hitlers Rede im Sportpalast etwa, am 8. April 1933. »Die habe ich im Radio gehört, ich habe ihn nicht verstanden. Und es war so langweilig«, sagt Fred Heyman. Für Nachrichten und klassische Musik hatte er damals nicht viel übrig. Er spielte lieber auf der Straße, wo er mit der Zeit eigenartige Dinge beobachtete. Zum Beispiel die brennenden Gebäude am 10. November 1938. Da war Manfred Heymann neun Jahre alt. Die Fasanenstraße sei gesperrt gewesen, erinnert er sich, überall standen Feuerwehrautos. »Das hat mich natürlich total interessiert – ich war doch ein kleiner Junge.« Die Synagoge stand in Flammen und auch seine jüdische Grundschule. »Ich hatte mich gefreut – endlich keine Schule mehr.«
Erst später verstand er, was er dort gesehen hatte. Der Satz eines Feuerwehrmannes schwirrt ihm noch heute durch den Kopf: »Verschwinde von hier, du Schweinehund.«
korea Auch den Tag, an dem ihn die Gestapo abholen wollte, hat er noch klar vor Augen. »Meine Mutter sagte damals: ›Du legst dich jetzt sofort ins Bett, du bist krank.‹ Ich verstand nicht und erwiderte: ›Aber Mutti, ich bin doch gar nicht krank!‹« Trotzdem tat er, was seine Mutter sagte – »Ich habe immer auf meine Mutti gehört.« Zwei Gestapo-Männer klopften kurz darauf an der Tür. Einer der beiden fühlte seine Stirn und meinte: »Na gut, wir nehmen ihn ein anderes Mal mit!«
»Aber ich war gar nicht warm, das kann nicht sein, ich war ja nicht krank«, erzählt Fred Heyman im Kleinen Saal des Gemeindehauses. War der Gestapo-Mitarbeiter also auch ein Aufrechter? »Lasst ihn uns als solchen sehen«, fordert er.
1946 beantragte Heymans Vater ein Ausreisevisum für die USA. »Wir mussten eine sehr unangenehme Ganzkörperuntersuchung über uns ergehen lassen.« In der Fremde angekommen, hatte der 17-Jährige es schwer. Seit dem Brand in der Fasanenstraße hatte er keine Schule mehr besucht, er sprach kein Englisch. Und: Später zogen ihn die Amerikaner für den Koreakrieg ein. »Ich war in der Infanterie, kämpfte an der Front. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles überlebt habe.«
familie Trotz all jener Ereignisse ging sein Leben weiter. Er heiratete, wurde Elektroingenieur, bekam einen Sohn. Heute ist er auch Großvater, nicht nur für seinen eigenen Enkel, sondern obendrein für all jene, die er im Rahmen des Schoa-Projekts kennengelernt hat – insgesamt 45 Jungen und Mädchen sind es bereits.
Zum erweiterten Familienkreis zählt auch die Familie Manthey, Nachkommen jener Berliner, die die Heymanns mit Lebensmitteln versorgten und Verstecke organisierten. Michael Manthey, der Enkel jener Großeltern, die sich beherzt für das Leben anderer engagierten, sitzt mit im Kleinen Saal. Er ist mit seiner Familie gekommen, um den Film anzuschauen, dem Gespräch zuzuhören und seinen Freund Fred später zum Friedhof zu begleiten. Denn sein Vater, Leopold Heymann, wurde in Berlin beigesetzt. »Hier war seine Heimat, er liebte sie«, sagt Fred Heyman.
Der Kontakt zwischen den Familien habe über die Jahrzehnte immer bestanden, sagt Michael Manthey. Über die Vergangenheit sei allerdings nie viel geredet worden. Aus einem einfachen Grund: »Die Freundschaft wurde einfach gelebt.«