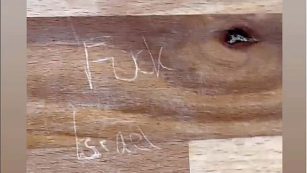Heinz Galinski ist allgegenwärtig. Die jüdische Grundschule in Berlin wurde nach ihm benannt, das Jüdische Krankenhaus befindet sich in der Heinz-Galinski-Straße, und zwei Gedenktafeln vor seinen ehemaligen Wohnungen erinnern an ihn. Ebenso die »Ruth-und-Heinz-Galinski-Bibliothek« in der Denmark High School in Jerusalem.
Vor 110 Jahren wurde der ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin (1949 bis 1992) und zweimalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland (1954 bis 1963 und 1988 bis 1992) geboren. Die Inschrift der Tafel an der Schönhauser Allee 31 würdigt ihn mit folgenden Worten: »Dr. h.c. Heinz Galinski, der maßgeblich an der Wiederherstellung des jüdischen Lebens und der Demokratie in Berlin beteiligt war, lebte hier 1938 bis 1943 und wurde aus diesem Haus nach Auschwitz deportiert. Nach Kriegsende kam er wieder nach Berlin und setzte sich für den Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde in Deutschland ein.«
auschwitz Als »unbequemen Mahner« beschrieb Galinski sich selbst. Er hätte Auschwitz nicht überlebt, um zu bestimmten Vorkommnissen zu schweigen, betonte er.
Heinz Galinski kam am 28. November 1912 in Marienburg im damaligen Westpreußen als einziges Kind einer streng religiösen jüdischen Familie zur Welt. Die Eltern hatten ein Textilgeschäft, und auch Heinz wurde Textilkaufmann. Vor den zunehmenden antisemitischen Schikanen suchten seine Eltern, seine Frau und er Zuflucht in der Anonymität der Großstadt Berlin.
Dort wurden sie zur Zwangsarbeit in Rüstungsbetrieben gezwungen. Im Februar 1943 holten Gestapo-Leute sie zur Sammelstelle für die Transporte nach Auschwitz ab. Der nicht transportfähige Vater kam auf die Polizeistation des Jüdischen Krankenhauses und starb dort 14 Tage später. Seine Frau sowie seine Mutter sah Heinz Galinski nie wieder. Für die I.G. Farben in Buna musste er Zwangsarbeit leisten.
evakuierung Im Januar 1945 wurde er im Rahmen der Evakuierung des Vernichtungslagers Auschwitz ins KZ Mittelbau-Dora verschleppt und nach dessen Räumung in das KZ Bergen-Belsen, wo er Mitte April 1945 von britischen Truppen befreit wurde. Er war der Einzige aus seiner Familie, der überlebte.
Galinski kehrte zurück nach Berlin und wurde als stellvertretender Leiter des Hauptausschusses für die Opfer des Faschismus, Abteilung Nürnberger Gesetze, beim Groß-Berliner Magistrat angestellt und beteiligte sich an der Gründung der »Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes« (VVN). Gleichzeitig engagierte er sich in der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Er wollte das Judentum transparent machen.
Unter seiner Leitung wuchs die Gemeinde. 1959 konnte das Jüdische Gemeindezentrum in der Fasanenstraße eingeweiht werden, an der Stelle, an der vor der Schoa die Synagoge gestanden hatte, die in der Pogromnacht abgebrannt war. Auch als Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland nahm Galinski zu tagespolitischen Fragen Stellung, mahnte gegen das Vergessen und warnte vor neuen antisemitischen Tendenzen.
Im Sommer 1975 entkam Galinski unverletzt einem von unbekannten Tätern verübten Paketbombenanschlag in Berlin.
ehrenbürger Mit der Ernennung zum Ehrenbürger würdigte Berlin 1987 sein »unermüdliches Eintreten für die Verständigung und den Ausgleich zwischen jüdischen und nichtjüdischen Menschen in Berlin« sowie sein »Engagement für die Jüdische Gemeinde zu Berlin und deren Ausstrahlung auf das kulturelle Leben in unserer Stadt«, heißt es beim Berliner Abgeordnetenhaus.
Seine zweite Ehefrau Ruth Galinski, geborene Weinberg (1921–2014), die er 1947 geheiratet hatte, berichtete in einem Interview mit der Jüdischen Allgemeinen vom Juli 2011 über den Alltag ihres Mannes. Jeden Morgen sei Heinz Galinski früh aufgebrochen und erst spätabends nach einem Arbeitstag von 16 Stunden zurückgekommen. Dann saßen die beiden zusammen und unterhielten sich bei einem Glas Wein. Nur über die Gemeinde wollte er dann nicht mehr sprechen, weil er sich den ganzen Tag mit ihr beschäftigt hatte.
Den Personenschutz habe er als nahezu unerträglich empfunden, denn er sei niemals allein gewesen. Selbst wenn er sich einmal einen Anzug kaufen wollte, sei der Personenschutz mitgekommen. Einmal, in den ersten Jahren als Gemeindechef, habe er sich von seinem Chauffeur zu Hause absetzen lassen, gewartet, bis seine Begleitung gegangen sei, und habe dann unangekündigt die Wohnung verlassen. Doch es sei aufgeflogen – und von da an wurde er noch mehr beschützt.
Eine Eigenschaft, die Ruth Galinski an ihrem Mann besonders schätzte, war seine Fähigkeit, sich zu entschuldigen. »Er konnte seine Fehler einsehen.« Er starb an ihrem Geburtstag 1992.