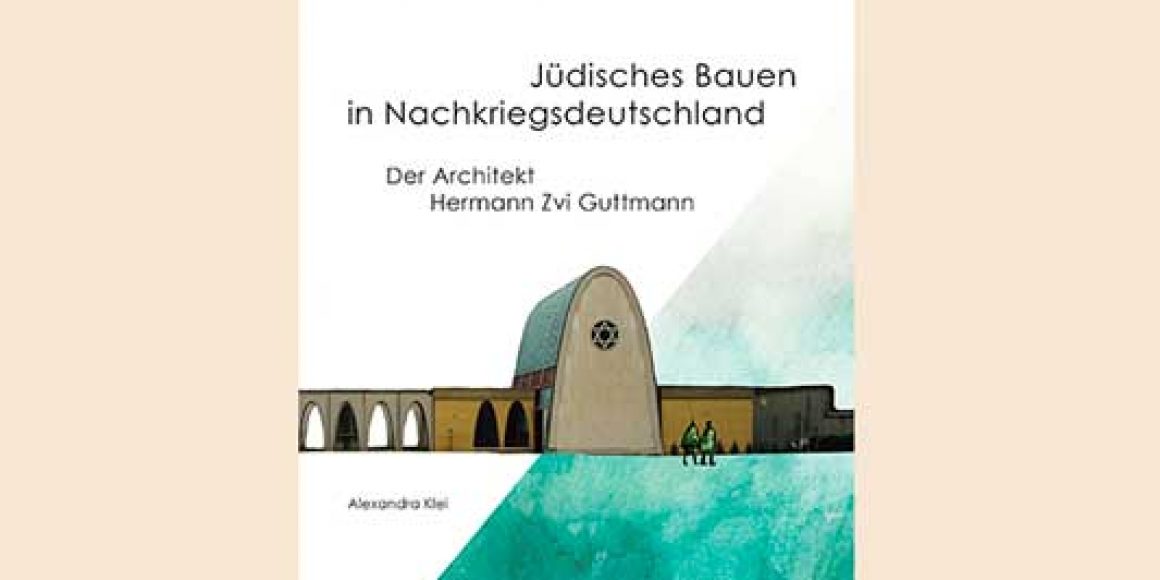Der Wiederaufbau der jüdischen Gemeinden in Westdeutschland nach der Schoa war mühsam und zäh. Die Gemeinden der deutschen Nachkriegsgesellschaft blieben klein, bis Anfang der 90er-Jahre russischsprachige Kontingentflüchtlinge kamen. Doch auch ihre finanziellen Möglichkeiten waren zu begrenzt, um die in der Pogromnacht und im Zweiten Weltkrieg zerstörten Synagogen wieder aufbauen zu können. Die Synagogenneubauten aus der Zeit des Wirtschaftswunders waren oft nicht nur klein und häufig am Stadtrand gelegen, sondern bewusst unscheinbar gestaltet.
Mit Hermann Zvi Guttmann gab es jedoch einen Architekten, dessen Entwürfe den Gemeinden zu signifikantem architektonischen Ausdruck und baulichen Gesicht verhalfen. Geboren 1917 im heute polnischen Bielitz, gestaltete er das jüdische Bauen nach 1945 maßgeblich. Nach dem Architekturstudium in München ging Guttmann Anfang der 50er-Jahre nach Frankfurt und entwarf Synagogen, Gemeindezentren, Mikwaot und Denkmäler.
Schutzbauten Guttmanns Werke spiegelten nicht nur den Bruch wider, der durch die Verfolgung und Vernichtung des deutschen Judentums entstanden war, sondern auch die anfängliche Zerbrechlichkeit jüdischen Lebens in der bundesdeutschen Gesellschaft. »Nach Auschwitz« sollten seine Synagogen ihren Gemeinden Schutz und dem Einzelnen Zuflucht und »innere Heimat« bieten.
Deutlich wird dies bereits bei seinem Entwurf der Neuen Synagoge in Offenbach 1956, dem ersten Synagogenneubau in Hessen nach 1945. Gegenüber der alten Synagoge gelegen, zeigt der Entwurf eindrucksvoll, wie moderne Architektur und jüdische Liturgie ebenso zusammenfinden wie Geschichtsbezogenheit und Zukunftsoptimismus: Die Mittelachse des Neubaus ist auf den Kuppelmittelpunkt der ehemaligen Synagoge ausgerichtet. Der Saalbau des Neubaus hingegen hat abgerundete Außenmauern, »die die Menschen wie in einem Tallit umhüllen«, hieß es damals.
Als die Gemeinde Mitte der 90er-Jahre schnell wuchs, wollte sie eine neue Synagoge bauen. Es folgte eine aufgebrachte Diskussion über die Bedeutung von Guttmanns Synagoge. Die Anerkennung als Kulturdenkmal bewirkte letztlich die Ergänzung um einen Neubau.
Rundungen Bei der 1958 eingeweihten Synagoge in Düsseldorf mit 400 Plätzen hat Guttmann die Form eines Ovals gewählt. Mit ihrer flachen Kupferhaube wirkt die Synagoge wie ein schützender Kokon. Die Vorliebe für weiche, organische Formen zeichnen auch die Bauten auf dem Jüdischen Friedhof in Hannover-Bothfeld aus: Die parabolische Bogenform von Guttmanns Trauerhalle wurde in den Arkaden aufgegriffen.
Guttmann, der 1977 starb, wird von der Autorin Alexandra Klei eingehend und fachkundig gewürdigt. Klei studierte Architektur und promovierte mit der Arbeit Der erinnerte Ort. Funktion und Bedeutung der Architektur nationalsozialistischer Konzentrationslager für die Abbildung und Präsentation von Geschichte. Sie war Lehrbeauftragte an der Ruhr-Universität in Bochum, forschte zur Architektur der Weißen Stadt Tel Aviv und ist seit dem Sommer 2014 am Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg tätig. Es ist ihr Verdienst, das bauliche Erbe von Guttmann zu würdigen und in die Nachkriegsgeschichte der jüdischen Gemeinden in (West-)Deutschland einzuordnen.
Alexandra Klei: »Jüdisches Bauen in Nachkriegsdeutschland – Der Architekt Hermann Zvi Guttmann«. Neofelis, Berlin 2017, 380 S., 29 €