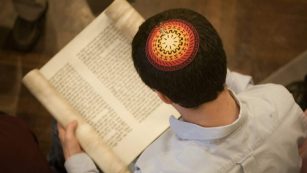Mit der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahre 70 n.d.Z. begann die Zerstreuung des jüdischen Volkes. Die römischen Besatzer erließen eine Reihe antijüdischer Gesetze, die zu einem Aufstand der in Judäa verbliebenen Juden führten.
Schimon ben Kosewa schaffte es, die Rebellen zu einen und die römischen Besatzer erfolgreich zu bekämpfen. Er nannte sich daraufhin Bar Kochba, Sohn des Sterns, sah sich selbst als Messias und regierte das Volk in einem autoritären Stil.
Doch die Römer schickten ihre besten Truppen nach Judäa, und so besiegten sie Bar Kochba und dessen Männer im Jahr 135, ungefähr drei Jahre nach dem Beginn des Aufstands. Daraufhin töteten die Römer Hunderttausende Juden, vertrieben die Überlebenden des Massakers und besiedelten die Region mit Syrern und Phöniziern. Erst im 20. Jahrhundert, mehr als 1800 Jahre nach dem Aufstand Bar Kochbas, lebten wieder mehrheitlich Juden im Land.
Folgen Der niedergeschlagene Aufstand und Bar Kochbas messianische Ansprüche hatten weitreichende Folgen für den Verlauf der jüdischen Geschichte.
Wie fast alle Juden in der damaligen Zeit setzen sich auch die Rabbinen des Talmuds mit Bar Kochba auseinander. Im Traktat Sanhedrin 93b wird berichtet, dass er sich selbst zum Messias ausrief. Die Weisen entgegneten ihm, dass der Messias die Gerechtigkeit riechen könne: Er habe die Fähigkeit, durch seinen Geruchssinn wahre richterliche Entscheidungen zu treffen.
Dass Bar Kochba dazu nicht in der Lage war, disqualifizierte ihn als potenziellen Messias. Daraufhin töteten ihn die Römer. Der Talmud verwendet an dieser Stelle nicht den Namen Bar Kochba, der eine Anspielung auf den Messias ist, sondern nennt ihn »Bar Kosewa« − Sohn der Lüge.
Hoffnungen Diese kurze talmudische Geschichte gibt Aufschluss über die Art und Weise, wie die Gelehrten Bar Kochba sahen: als einen Mann, der zwar messianische Hoffnungen weckte, aber nicht über die Fähigkeiten des Messias verfügte und durch sein vernichtendes Ende bewies, dass die an ihn geknüpften Hoffnungen eine Lüge waren.
Interessant ist, wieso die Rabbinen der Meinung waren, der Messias müsse einen überirdischen Geruchssinn haben. Der Grund dafür liegt in einer Interpretation der Worte des Propheten Jeschajahu: »Und Wohlgefallen (Haricho) wird er (der Messias) haben an der G’ttesfurcht, Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören« (11,3).
Die Weisen interpretieren das Wort für Wohlgefallen (Haricho) auch als Geruchssinn. Dementsprechend richtet der Messias laut dieser Interpretation der Worte des Propheten Jeschajahu nicht mit dem, was seine Augen sehen oder seine Ohren hören, sondern mit dem, was ihm sein Geruchssinn vermittelt.
Doch wie kommen die Weisen darauf, die Prophetenworte so zu deuten? Es wird sicherlich versteckte und mystische Gründe geben. Die Kabbala diskutiert ausführlich die mystische Signifikanz des Messias und seiner Fähigkeiten.
Ich denke, einer der augenscheinlichen Gründe für eine solche Interpretation ist, dass die Weisen des Talmuds wussten: Die Zukunft des jüdischen Volkes wird von ihren Worten geprägt. Die Weisen wollten ein klares Bild von dem aufzeigen, wie der künftige Messias sein sollte, damit das Volk vor gefährlichen selbst ernannten messianischen Hoffnungsfiguren geschützt wird.
Anforderungen Der Messias, so die Weisen, wird eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen müssen, um als solcher gelten zu dürfen.
In den folgenden Jahrhunderten tauchten einige weitere Personen auf, die sich als Messias bezeichneten. Schabbatai Zwi (1626−1676) und Jakob Frank (1726−1791) sind wohl die berühmtesten von ihnen. Sie tauchten immer dann auf, wenn die Menschen litten und sich nach Erlösung sehnten. Ihr Größenwahn stürzte sie gemeinsam mit ihren Anhängern ins Verderben.


Gerechtigkeit riechen
Warum Bar Kochba nicht der Maschiach war
von
Vyacheslav Dobrovych
29.01.2021 10:53 Uhr