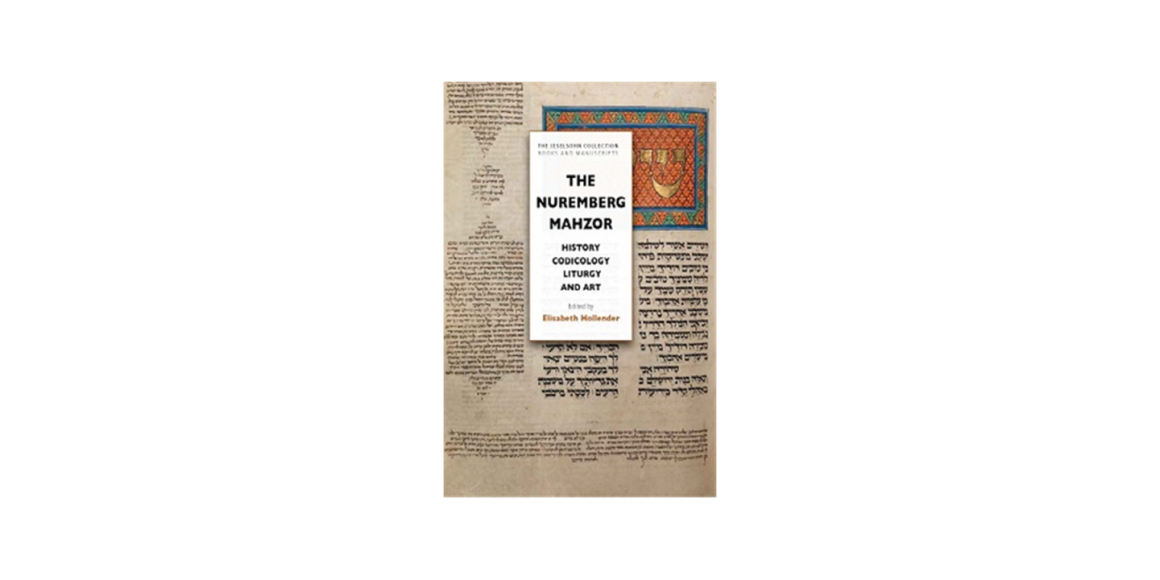Von den hebräischen Manuskripten, die im Mittelalter geschrieben wurden, sind schätzungsweise nur fünf Prozent erhalten geblieben. Erfreulicherweise wurde ein außergewöhnliches Werk aus dem 14. Jahrhundert, das aus mehr als tausend Pergamentseiten besteht und 28 Kilogramm wiegt, nur leicht beschädigt, und zwar durch den Diebstahl einiger Blätter. Es handelt sich um einen auch in ästhetischer Hinsicht beeindruckenden Machsor, ein Gebetbuch für die besonderen Tage des jüdischen Jahres.
Der »Nürnberger Machsor« wurde, so ist dem Kolophon zu entnehmen, am 8. August 1331 fertiggestellt. Der Schreiber vermerkte den Namen des Auftraggebers – ein sonst unbekannter Jude: Jehoschua ben Jizhak –, aber er ließ unerwähnt, wo er sein Meisterwerk geschaffen hat. Die in der Literatur übliche Bezeichnung »Nürnberger Machsor« kommt daher, dass dieses prachtvolle Gebetbuch sich mehr als 400 Jahre in der Stadtbibliothek von Nürnberg befand, wo es einst Leopold I., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, gesehen haben soll. Rabbiner Bernhard Ziemlich vermutete in seiner 1886 veröffentlichten Monografie über den Nürnberger Machsor, das Manuskript sei in Regensburg entstanden.
Der Nürnberger Machsor könnte gar nicht aus Nürnberg stammen
Die Annahme, das Werk sei nicht in Nürnberg geschrieben worden, diente der Stadtbibliothek als ein Argument, um den Machsor 1951 an den Geschäftsmann und Mäzen Salman Schocken zu verkaufen, der ihn nach Israel brachte. Dessen Enkel haben im Jahre 2007 das Buch an den Sammler David Jeselsohn verkauft. Jeselsohn konnte mehrere Fachleute für die Untersuchung des Manuskripts gewinnen, und er hat die nun vorliegende Publikation der Forschungsergebnisse finanziell unterstützt.
Der neue Sammelband unterstreicht, dass im Mittelpunkt des Nürnberger Machsors Pijutim stehen, das sind hebräische Dichtungen für die Liturgie. Mehr als 700 Pijutim finden sich in dem Werk! Für den Sammelband haben Jona Fränkel und sein Sohn Avraham Fränkel eine Einführung in die Welt der Pijutim verfasst; ins Detail gehend beschreiben sie Besonderheiten, die man im Manuskript feststellen kann. Auch stellen die Liturgieforscher einige bedeutende Dichter und ihre Werke kurz vor.
Pijutim sind sprachlich sowie inhaltlich nicht leicht zu verstehen, Kommentare sind deshalb sehr hilfreich, und dieses Genre erfreute sich im Mittelalter großer Beliebtheit. Der Nürnberger Machsor enthält mehr Pijut-Kommentare als irgendein anderes Manuskript – insgesamt Erläuterungen zu 419 Pijutim!
Das mittelalterliche Werk wurde einst im Religionsunterricht studiert
Elisabeth Hollender, Judaistik-Professorin an der Frankfurter Universität, hat sie sorgfältig studiert; sie stellte fest, dass der Kompilator Kommentare aus verschiedenen Sammlungen ausgewählt hat. Die Erläuterungen zu den liturgischen Dichtungen beweisen, dass der Machsor nicht nur für den Vorbeter in der Synagoge bestimmt war. Pijutim und Kommentare wurden im Religionsunterricht der damaligen Zeit studiert.
Auch der Kunst im Nürnberger Machsor sind im Sammelband Abhandlungen gewidmet. Die Jerusalemer Kunsthistorikerin Anna Nizza-Caplan würdigt das Können des mittelalterlichen Schreibers Mattania und beschreibt die Arbeit von Jacob, der die Randbemerkungen in eine schöne Form gebracht hat. Auch geht diese Autorin auf die Tiersymbolik in den Illustrationen ein. Was bedeutet zum Beispiel der Elefant auf der allerersten Seite des Machsors?
Die vorbildlich aufgemachte Neuerscheinung in englischer Sprache, nach Ziemlichs Studie von 1886 erst das zweite Buch über den Nürnberger Machsor, wird sicher jedem gefallen, der die Möglichkeit erhält, im umfangreichen Buch zu blättern.
Dass bisher nicht sämtliche Rätsel um das alte Werk gelöst werden konnten, ist kaum verwunderlich. Wir müssen nicht unbedingt wissen, wo das prächtige Manuskript entstand und wer die fehlenden Seiten entwendet hat. Vielleicht wird jemand die gestohlenen Blätter eines Tages irgendwo finden.
Elisabeth Hollender (ed.): »The Nuremberg Mahzor. History, Codicology, Liturgy and Art«. Published by The Hebrew University Magnes Press, Jerusalem 2025. XXIII und 489 S., 150 US$