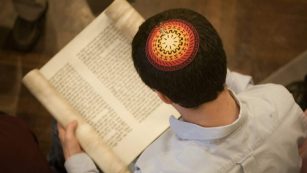Herr Rabbiner Vernikovsky, was bedeutet die Aufnahme der SchUM-Stätten konkret für die jüdischen Gemeinden vor Ort?
Für die jüdischen Gemeinden in Speyer, in Worms und in Mainz bedeutet es, dass sie nun wissen, dass sie rituelle Eigentümer von jüdischen Stätten sind, die Weltkulturerbe sind. Sie stehen in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese Kultusstätten auch in Zukunft erhalten, gefördert und gepflegt werden. Die jüdischen Gemeinden sind Teil eines sehr großen Projektes, das auch über die Regionen hinausgeht. Es sind die ersten jüdischen Weltkulturerbestätten überhaupt in Deutschland.
Übernehmen die Gemeinden damit auch gewissermaßen eine Art Vorbildfunktion?
Ob man sich jetzt als Vorbild fühlt, das vermag ich nicht zu sagen, aber wir haben eine Aufgabe zu erfüllen – und das tun wir sehr gern. Wir haben die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass über die Kultusstätten Judentum ganz anders vermittelt wird. Wir haben in der Frage, wie diese Stätten Besuchern zugänglich gemacht werden, wie sie thematisch und inhaltlich kommuniziert werden, auch Gestaltungsfreiheit. Das kann alles sehr spannend werden.
Wie sollen Inhalte vermittelt werden?
In allen drei SchUM-Städten sollen Besucherzentren entstehen, das ist der Plan. In Mainz wird voraussichtlich ein Besucherzentrum am historischen Friedhof sein, in Worms und Speyer läuft die Suche nach einem Platz. Die jüdischen Gemeinden sind in diese Prozesse eingebunden. Und das ist wichtig, dass wir mit dabei sind. Wir machen gestalterisch mit, lassen Ideen einfließen. Dieses schöne Werkzeug, das wir nun in der Hand haben, wollen wir so nutzen, dass viel mehr über Judentum in Deutschland gelernt wird.
Der Wormser Friedhof gibt 1000 Jahre jüdische Geschichte wieder.
Wenn es ums Lernen geht: Wie wird die Geschichte digital für Schülerinnen und Schüler aufgearbeitet?
Auch in diesem Bereich wird einiges passieren. Die Stadt Mainz hat eine App entwickelt, die sich mit den jüdischen Aspekten des alten Magenza beschäftigt, mit der Geschichte von SchUM. Ich glaube, dass es, was Schülerinnen und Schüler angeht, ein großes Interesse seitens des Landes geben wird. Eine SchUM-Stadt wie Worms, die sicherlich von allen dreien die interessanteste ist, weil sie »am meisten« an SchUM zu bieten hat, wird sicherlich von vielen Schülerklassen besucht werden, um sich den Synagogenbezirk anzusehen – mit der Mikwe, mit dem Raschi-Lehrhaus, mit dem wirklich einmaligen mittelalterlichen Friedhof. In der Stadt kann man sehr viel über die Geschichte des Judentums in Worms erfahren.
Zu welchem Ort haben Sie eine besonders emotionale Verbindung?
Tatsächlich ist dies der alte Friedhof in Worms. Er ist in sich vollständig, und dieser Friedhof gibt 1000 Jahre jüdische Geschichte wieder. Wir haben es mit Monumenten und Stilrichtungen aus allen möglichen Epochen dieser Zeit zu tun. Und es ist auch ein Ort, auf dem unglaublich bedeutende Gelehrte des Judentums beigesetzt wurden. Wie der MaHaRam, der MaHaRIL: mittelalterliche Schriftgelehrte, die aber das aschkenasische Judentum maßgeblich geprägt haben. Dass dieser Friedhof so vollständig ist und in sich eine gewisse Ästhetik hat, das sieht man beim Besuch.
Sie haben zum Ende der Veranstaltung ein Gebet gesprochen. Welches war es?
Ich wurde gefragt, ob ich zum Abschluss noch ein Gebet zitieren könne, und habe überlegt, welches dafür geeignet wäre. Viele Gebete wurden in dieser SchUM-Epoche verfasst und kanonisiert. Und sie werden heute noch benutzt. Trauergesänge zählen dazu, aber auch Gebete der Hohen-Feiertage-Liturgie. Ich habe mich für ein Gebet entschieden, das Teil des Rosch-Haschana-Morgengebets ist. Eine kurze Passage, in der es um die Vergänglichkeit, beinahe schon Nichtigkeit des Menschen geht. Der Mensch ist ein provisorisches Wesen gegenüber der Absolutheit des Göttlichen. Und diese Gegenüberstellung wird in diesem Gebet sprachlich sehr schön dargestellt.
Mit dem Rabbiner der Jüdischen Kultusgemeinde Mainz-Rheinhessen sprach Katrin Richter.