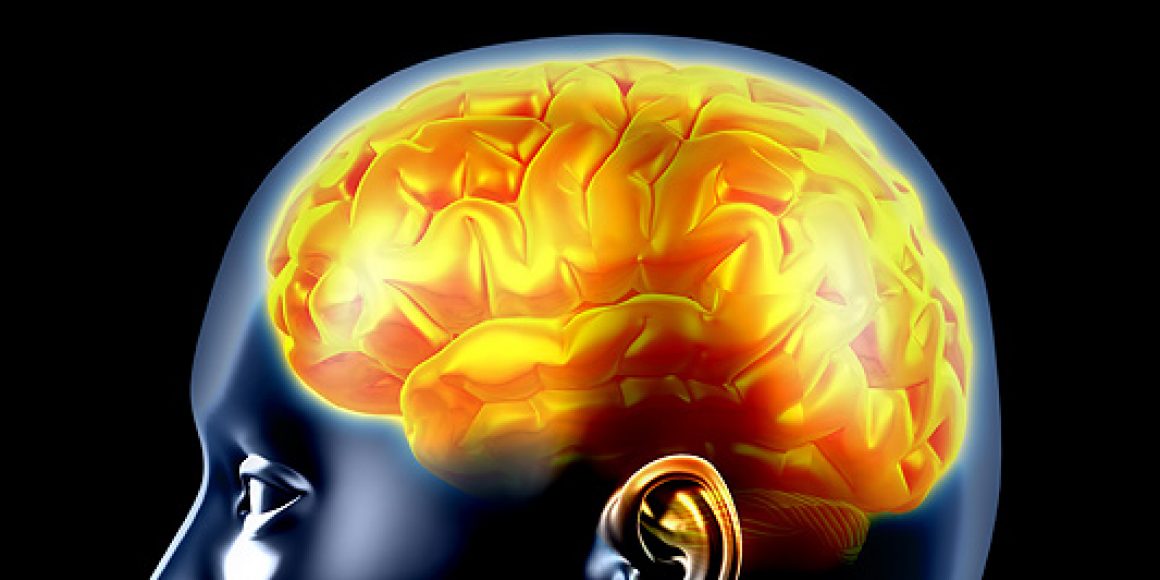Der deutsche Staat geht neue Wege. Wie die Bundesregierung entschied, sollen einem Informanten für geheime Daten 2,5 Mil- lionen Euro gezahlt werden, um Steuerbetrüger zu überführen. Die Politiker haben heftig darüber gestritten, ob es erlaubt ist, gestohlene Daten zu nutzen. Eine ethische Diskussion sollte allerdings schon vorher beginnen – dort, wo die Paraschat Teruma anfängt.
Moses Mendelssohn (1729–1786) übersetzt das Wort »Teruma« mit »Steuern, die entrichtet werden müssen«. Nach der Tora soll diese Steuer jeder geben, der es von Herzen tut. Das hebräische Verb »lenadew« setzt einen freiwilligen, gut gemeinten Beitrag voraus. Die Tora hat in unserer Parascha tatsächlich eine freiwillige Steuer im Sinn. Es soll dem Herzensantrieb jedes Einzelnen überlassen sein, wie viel er von dem Benötigten gibt. Ist so etwas überhaupt möglich?
Der Philosoph Peter Sloterdijk weist darauf hin, dass »die Gesellschaftsmaschine bis auf Weiteres nur von den Leistungen der Steueraktiven lebt«, die jedoch in seinen Berechnungen eine relative Minderheit sind (25 Millionen von 82 Millionen Einwohnern der Bundesrepublik). Sloterdijk möchte eine »Gesellschaft voranbringen, die auf einem Wettbewerb stolzer Geber beruht«. Er spielt mit dem Gedankenexperiment, dass die Summe der Zwangssteuer auch durch spontane Abgaben der Bürger zusammenkommen kann.
Geberkultur An etwas Ähnliches muss schon der Kommentator Baal ha-Turim (1269–1343) gedacht haben, als er bei dem Tora-Wort »wenatenu« (und sie werden/ sollen geben) bemerkte, dass es ein Palindrom ist: Egal, ob man das hebräische Wort von rechts nach links oder in umgekehrte Richtung liest – es heißt dasselbe. Dies soll uns lehren, dass, egal was eine Person gibt, es zu ihr zurückkommt. So gesehen kann man sich auch einen gesellschaftlichen Umbau nach Sloterdijk vorstellen, der eine dumpfe Hinnahme der Abgaben durch eine aktive Geberkultur ersetzt sehen möchte.
Doch ist das nicht naiv und utopisch? Der Maggid von Dubnow (1741–1804) erzählt von einem Schtetl. Dort hat sich die Gemeinde entschieden, dass ein Mal jede Woche etwas Wein in ein großes Fass in der Synagoge geschüttelt werden solle, damit an Purim genug für alle da ist. Doch als man das Fass an Purim öffnet, sind alle erschrocken: Statt Wein ist Wasser darin. Jeder hatte gedacht, es sei zum eigenen Vorteil, Wasser hineinzuschütten und gehofft, es werde am Ende nicht auffallen. Doch weil alle so dachten, wurde es zum Verhängnis.
Soll man also jede Hoffnung auf den menschlichen Edelmut aufgeben? Stimmt die von einigen Denkern vertretene Fassadentheorie, wonach der Mensch im Kern böse und sein moralisches Verhalten nichts mehr als eine Fassade sei, mit der er über seine wahren, egoistischen Absichten täuschen will? Nein, denn das würde dem Siddur-Text über die »Neschama tehora«, einem in seinem Kern reinen Element, widersprechen.
zufriedenheit Zudem gibt es einen evolutionsbiologischen Ansatz, der davon ausgeht, dass moralisches Verhalten zur Natur des Menschen gehört. Auch wenn es dem, was wir lesen, hören oder erleben zu widersprechen scheint, gibt es doch ernsthafte Forschungsergebnisse, die belegen, dass der Mensch einen angeborenen Moralsinn besitzt. Menschlicher Altruismus basiert auf den allgemeinen neuronalen Systemen der Belohnung und der sozialen Bindung. Wenn wir freiwillig geben, darin unterstützt werden und die positive Auswirkung des Gebens sehen können, dann kommt es dabei in unserem Gehirn zu physiologischen Veränderungen: Der Neurotransmitter Dopamin im Belohnungszentrum sorgt für Zufriedenheit, Oxytocin für Vertrauen. Das gute Gefühl verstärkt dann das spezifische Verhalten des Gebens.
Wenn alles so gut funktioniert, warum verhalten wir uns dann oft unmoralisch? Weil die Beachtung moralischer Prinzipien ein intaktes Frontalhirn (den präfrontalen Cortex) erfordert, das mit anderen Hirnbereichen zusammenarbeiten muss. Wenn das nicht geschieht, stellt sich unsoziales Verhalten ein, und wir verweigern uns dem Spendenaufruf.
moralorgan Aufgrund dieser Überlegungen können wir uns fragen: Sind die Mizwot dazu da, unsere positiven Impu0lse zu fördern und unseren angeborenen Moralsinn weiterzuentwickeln, oder sollen die Mizwot die negativen Impulse unterdrücken und damit gegen unsere fehlerhafte Natur laufen? Ich denke, das Erste ist der Fall. Unser Wochenabschnitt behauptet, dass diese Steuer (Teruma) von jedem entrichtet werden soll, dem es sein Herz geben wird. Wenn dabei – unglücklicherweise – die schlechten Züge die angeborene positive Einstellung überlagern, muss eine konkrete und strikte Forderung aufgestellt werden. Der Anfang der Paraschat Teruma erinnert uns daran, dass wir Menschen mit einem »Moralorgan« zur Welt kommen, das in uns ein Leben lang effektiv funktionieren soll.
Der Autor ist Rabbiner der Liberalen jüdischen Gemeinde Beth Shalom in München.