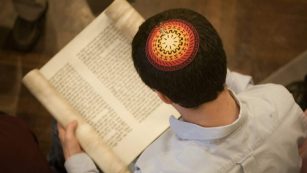Warum wir Anfang Februar in Deutschland das Neujahr der Bäume, Tu Bischwat, feiern, leuchtet auf den ersten Blick vielleicht nicht jedem ein. Doch immerhin werden die Tage länger, und in Israel erwachen Flora und Fauna schon aus ihrer Winterruhe. Die ersten Frühblüher zeigen sich, die Bienen und Vögel fliegen aus. Der jüdische Monat Schwat verweist auf die Erneuerung der Natur in Israel – und in der Diaspora können wir uns an Tu Bischwat (am 4. Februar) zumindest schon auf den kommenden Frühling freuen.
Am Tu Bischwat-Fest, am 15. Tag des Monats Schwat, bringen wir die Verbindung zwischen Mensch und Natur zum Ausdruck, indem wir Bäume pflanzen und von den »Sieben Arten« Israels essen: Weizen, Gerste, Datteln, Feigen, Oliven, Granatäpfel und Weintrauben. Doch was sagt das Judentum prinzipiell zum Verhältnis des Menschen zur Natur, zur Pflanzen- und Tierwelt, zur Erde und zum Wasser?
Eimer Der Monat Schwat steht im Sternzeichen des Wassermanns – oder des Eimers. In einer antiken Synagoge, die in Bet Alfa im Norden Israels steht, fanden Archäologen ein Mosaik mit dem Symbol eines Eimers für den Schwat. Im 4. Buch Mose 23,7 finden wir die Stelle: »Aus seinen Eimern rinnt Wasser, an reichen Wassern seine Saat«. Im Monat Schwat ist der meiste Regen des Winters schon gefallen, und die Brunnen und Wassergruben sind voll. Das Wasser muss nicht mehr vom Grund des Brunnens geschöpft werden, sondern kann von der Oberfläche geholt werden. Nach dem Schöpfen läuft der Eimer oft über.
Eine enge Beziehung zwischen Mensch und Umwelt finden wir in der Tora schon bei der Geschichte von der Erschaffung der Welt. Dazu lesen wir im 1. Buch Mose 1, 28: »Und G’tt segnete sie (Adam und Eva) und sprach zu ihnen: ›Seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und bezwingt sie, und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen.‹«
Wenn wir dieses Kapitel lesen, lernen wir zunächst daraus, dass der Mensch über die Natur herrschen und diese für seine Bedürfnisse so nutzen kann, wie es ihm passt. Alles wurde nur für den Menschen geschaffen – Tieren und der Natur wurden keine Rechte zugesprochen. Würde man diesen Vers isoliert betrachten, wäre er ein Freibrief zur totalen Ausnutzung und Ausbeutung der Umwelt.
Schabbat Doch im Talmudtraktat Sanhedrin, Blatt 38, Seite 1 steht, dass der Mensch an Erew Schabbat (Freitagnachmittag) geschaffen wurde, also ganz zum Schluss der Schöpfungsgeschichte. Und in der Gemara fragt man sich: Warum?
Die Antwort ist: Der Mensch soll nicht zu stolz werden und sich einbilden, er sei das Wichtigste bei der Erschaffung der Welt gewesen. Wenn er jedoch behauptet, er besitze Möglichkeiten, die Tiere und Pflanzen nicht haben, dann sei ihm gesagt: Die Mücke ist schon vor ihm erschaffen worden.
Ein Mensch, der das religiöse Ziel, G’tt zu dienen und unter anderem den Schabbat zu halten, verfehlt, indem er von sich behauptet, er stehe über allen Dingen, und sich nicht dem Ewigen unterwirft, dessen Wert ist geringer als der einer kleinen Mücke oder anderer Tiere. Denn die Welt wurde nicht erschaffen, damit der Mensch alles in egoistischer Weise nur für sich nutzen soll, sondern als Instrument, um G’tt zu dienen.
Dazu betrachten wir folgende Verse im 1. Buch Mose 1, 29–30: »Und G’tt sprach: Seht, ich gebe euch alles Kraut, das Samen trägt, auf der Oberfläche der ganzen Erde und alle Bäume, an denen Baumfrucht die Samen trägt; euch sei es zum Essen. Allen Tieren des Landes aber und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, worin ein Lebensodem ist, gebe ich alles grüne Kraut zum Essen.«
Bäume In diesen beiden Versen zeigt sich, dass der Mensch und die Tiere in der Nahrungsfrage gleichwertig sind. Der Mensch sollte fleischlos wie das Tier leben: Zur Zeit der ersten Menschen war nur der Verzehr von den Früchten der Bäume erlaubt, die Samen tragen und sich immer wieder erneuern konnten. Tiere hingegen durften alle Pflanzen verzehren.
Der Mensch kann Moral und Ethik einsetzen, hat einen Verstand und ist G’ttes Ebenbild, deshalb wird von ihm auch mehr verlangt als von den Tieren. Er kann seine Bedürfnisse regulieren und ist durch angemessenes Verhalten in der Lage, Nahrung auch für die nächste Generation zu gewährleisten.
Der Mensch darf nicht tun und lassen, was er will. Er muss ein Teil der Umwelt sein und durch sein Verhalten eine Balance schaffen. Später jedoch, in Zeiten von Noach, nach der Sintflut, wurde der Verzehr von Fleisch erlaubt. Nach der Toraübergabe am Sinai erfolgte eine neue Epoche mit Speisegesetzen, die für uns bis heute Gültigkeit haben.
Grenzen Im 1. Buch Mose, 2, 15 steht: »Und G’tt, der Ewige, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre.« Hier ist das Wort »bewahre« ausschlaggebend. Dem Menschen sind Grenzen gesetzt. Auch in den folgenden Versen werden wir darauf hingewiesen: »Wenn du eine Stadt lange Zeit einschließt und bekriegst, um sie einzunehmen, so sollst du die Bäume um sie herum nicht zerstören, indem du die Axt gegen sie schwingst, sondern sollst nur von ihnen essen, sie selbst aber nicht umhauen. (...) Nur einen Baum, von dem du weißt, dass er kein Fruchtbaum ist, den darfst du zerstören und umhauen, um gegen die Stadt, die mit dir Krieg führt, Belagerungswerke zu bauen, bis sie fällt (5. Buch Mose, 20, 19–20).
Die Tora ermahnt uns, auch in Zeiten des Krieges, in denen viele Ausnahmezustände bestehen, auf die Natur zu achten und Grenzen nicht zu überschreiten, denn der Mensch ist wie ein Baum auf dem Felde. Der Mensch wurde als Ebenbild G’ttes erschaffen, der in der Lage ist, Gut und Böse zu unterscheiden.
Im Sinne der Tora wird vom Menschen Produktivität und Innovationsgeist verlangt. Er soll sich weiterentwickeln, da die Welt auch für ihn geschaffen worden ist. Jedoch ist er verpflichtet, das Geschenk
G’ttes zu erhalten und mit der Umwelt in Harmonie zu leben.
Das Judentum sucht hier einen Mittelweg: »Le Owda u le Schomra« – das heißt, bebaue und bewache. Einerseits dürfen wir alles auf der uns geschenkten Welt nutzen, aber nur unter Einschränkungen, damit diese Welt nicht nur für uns, sondern auch für die zukünftigen Generationen erhalten bleibt. Der Monat Schwat ist eine ideale Zeit, um uns daran zu erinnern.
Der Autor ist Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz (ORD).