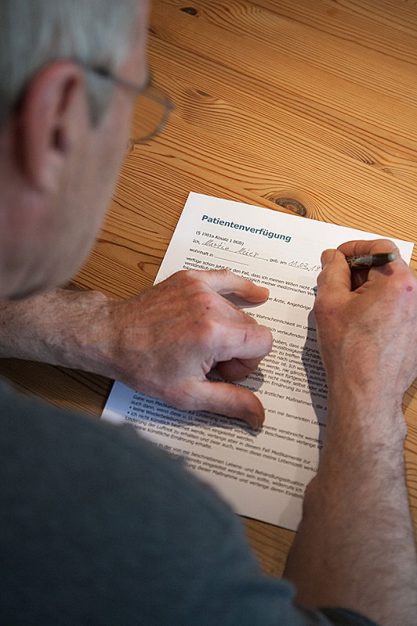Durch den enormen medizinischen Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte können viele Krankheiten, die früher in kürzester Zeit zum Tode führten, besser behandelt werden. Leider gelingt es jedoch nicht immer, eine Heilung zu erzielen. Der medizinische Fortschritt hat auch dazu geführt, dass immer mehr Menschen nach überstandenen schweren Erkrankungen mit körperlichen und psychischen Einschränkungen leben müssen – und mit Hinfälligkeit, die durch ihr hohes Alter bedingt ist.
In Deutschland sterben drei Viertel aller Menschen nicht zu Hause, sondern in Krankenhäusern. 2,3 Millionen Menschen leben in Pflegeheimen, jeder Fünfte von ihnen ist schwerst pflegebedürftig. Als Pflegefälle verlieren diese Menschen oft ihre Selbstständigkeit.
Krankheit Nicht selten äußern sie selbst – oder ihre Angehörige empfinden es so –, dass sie dadurch viel an Würde verlieren. Musste man früher lernen, zu akzeptieren, dass es bei schwerer Krankheit meist keine Möglichkeit gab, das Leben zu verlängern, sieht die Gesellschaft heute einen großen Bedarf, richtige Entscheidungen über Fortführung oder Begrenzung lebensverlängernder Maßnahmen im Sinne der Betroffenen zu fällen.
Zu Recht befürchten viele Menschen, in Situationen geraten zu können, in denen sie im entscheidenden Moment nicht mehr selbst über ihre Behandlung bestimmen können. Hier kann das Verfassen einer Patientenverfügung oder die Bestimmung eines Vorsorgebevollmächtigten das Risiko vermindern, dass aus Sicht der Betroffenen falsche Entscheidungen gefällt werden.
Versäumt man aber, eine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung zu erstellen, könnte ein Gericht die gesetzliche Betreuung durch einen Berufsbetreuer anordnen – und zwar in dem Fall, dass man durch eine Notfallsituation plötzlich entscheidungsunfähig wird und Unklarheit in entscheidenden Fragen besteht.
Dilemma Für Juden besteht dabei ein besonderes Problem: Fraglich ist, ob ein gerichtlich bestimmter Betreuer, der selbst nicht Jude ist, bei seinen Entscheidungen, die er für einen von ihm betreuten Juden zu treffen hat, halachische Aspekte berücksichtigt.
Da es sich bei Patientenverfügungen beziehungsweise Patiententestamenten letztlich um die Vorwegnahme einer Einwilligung oder Ablehnung möglicher zukünftiger medizinischer Behandlungen handelt, wird immer wieder die Frage gestellt, ob das halachisch überhaupt zulässig ist – oder ob es der jüdischen Verpflichtung, das Leben zu erhalten, widersprechen könnte.
Die oben erwähnten Fortschritte der modernen Medizin haben die früher gültigen klaren Vorstellungen über die Grenzen zwischen Leben und Tod verändert und eine Fülle halachischer Fragen aufgeworfen. Aufgrund der Komplexität dieser halachischen Fragen wundert es nicht, dass es in der modernen pluralistischen jüdischen Welt je nach religiöser Strömung unterschiedliche Auffassungen zu den immer wiederkehrenden Fragen am Lebensende gibt.
Das Abfassen einer Patientenverfügung oder die Entscheidung, wem man als Vorsorgebevollmächtigtem die Aufgabe erteilt, im Falle der eigenen Entscheidungsunfähigkeit die richtigen Entscheidungen zu treffen, kann sicherstellen, dass am Lebensende und über den Tod hinaus gemäß der Halacha, wie man sie selbst für sich als verbindlich definiert, gehandelt wird.
Bevollmächtigter Deshalb sollte sich jeder mit seinem Arzt, seinen Angehörigen und seinem Rabbiner über seine Vorstellungen und Wünsche bezüglich des eigenen Sterbens austauschen und als Ergebnis eine Patientenverfügung abfassen, die die eigene Haltung wiedergibt beziehungsweise einen Vorsorgebevollmächtigen benennen, der diese Haltung kennt und im Bedarfsfall danach entscheidet.
Entwickelt man früh genug klare Vorstellungen und Anweisungen für das eigene Lebensende, kann vielen möglichen Katastrophen vorgebeugt werden, die leider oft genug passieren. So kann ein der klassischen halachischen Auffassung folgender Jude festlegen, dass er zur Erhaltung des Lebens im Bedarfsfall auch über eine durch die Bauchdecke eingeführte Sonde künstlich ernährt und mit Wasser versorgt werden soll, sollte er sein Bewusstsein unwiederbringlich verlieren und nicht mehr schlucken können. Ein anderer Jude könnte für die gleiche Situation verfügen, dass er der progressiven Halacha folgt und genau dies ablehnt, weil er darin ein künstliches Hinauszögern des Todes durch einen medizinischen Eingriff sieht – und für ihn das Unvermögen, zu schlucken, bereits Teil des Sterbeprozesses ist.
Da es keine bislang keine deutschsprachigen Vorlagen für speziell jüdische Willensverfügungen gibt und die Bedenken nachvollziehbar sind, ob die in Deutschland gängigen Vorlagen halachisch korrekte Vorausverfügungen ermöglichen, werden oft gar keine Patientenverfügungen erstellt.
Israel Es mag erstaunlich klingen, aber so sehr unterscheiden sich die Formulierungen und Aspekte der hierzulande verfügbaren Muster für Patientenverfügungen gar nicht von den halachisch überprüften Vordrucken aus Israel.
In Israel gibt es seit Längerem gesetzliche Regelungen, die allgemeine Richtlinien zu Therapieentscheidungen für und bei Patienten am Lebensende definieren und bei deren Formulierungen ein Gleichgewicht zwischen den Prinzipien der Halacha, insbesondere der Heiligkeit des menschlichen Lebens auf der einen Seite und der Bedeutung von Lebensqualität, Menschenwürde und dem Recht eines Menschen auf Verwirklichung seiner Autonomie auf der anderen Seite, angestrebt wurde.
Der Gesetzesvorschlag hierzu wurde zwischen 2000 und 2004 unter Leitung des Rabbiners, Arztes und Medizinethikers Avraham Steinberg von einer multiprofessionellen Kommission erarbeitet. In dieser Kommission arbeiteten israelische Rabbiner, Ärzte, Philosophen, Ethiker und Juristen einen über 100 Paragrafen umfassenden Gesetzesvorschlag aus, der mit dem 2005 verabschiedeten Gesetz heute in Israel die Grundlage für Entscheidungen am Lebensende in Einklang mit der Halacha, auch nach orthodoxen Maßstäben, darstellt.
Detailliert werden Fragen betrachtet, die sich im medizinischen Alltag immer wieder ergeben und uns rasch überfordern können, wenn wir schnelle Antworten geben müssen: Wie weit soll die ärztliche Behandlung im Endstadium gehen? Darf eine bereits eingeleitete ärztliche Behandlung abgebrochen werden, wenn sich erweist, dass sie erfolglos bleiben und durch sie keine lebenswerte Zeit gewonnen wird?
Herzschrittmacher Darf in bestimmten Situationen, zum Beispiel im Falle, dass unumkehrbar das Bewusstsein verloren ist und bleiben wird, eine medizinisch mögliche und machbare ärztliche Behandlung unterlassen werden? Und sind künstliche Ernährung und intravenöse Flüssigkeitsgabe medizinische Maßnahmen – oder entsprechen sie der »normalen« Nahrungsaufnahme im Sinne von Essen und Trinken und müssen also in jedem Fall fortgeführt werden? Dürfen Herzschrittmacher oder eingepflanzte Defibrillatoren am Ende des Lebens deaktiviert werden?
Sehr anschaulich und klar werden die praktischen Aspekte zum Abfassen von Willensverfügungen und der Benennung von Vorsorgebevollmächtigten dargestellt. Solange wir in Deutschland keine eigenen Anleitungen und Vorlagen für spezifisch jüdische Patientenverfügungen haben, können dieses von Liberalen und Orthodoxen gleichermaßen anerkannte israelische Gesetz und die Veröffentlichungen der Steinberg-Kommission Leitfaden für Ärzte und Rabbiner sein, die um Rat und Unterstützung beim Verfassen einer Patientenverfügung gebeten werden.
Wünschenswert bleibt, dass wir bald auch hierzulande jüdische Vorlagen für Patiententestamente zur Verfügung haben.
Der Autor ist leitender Oberarzt für Palliativmedizin am Klinikum Bielefeld und stellvertretender Vorsitzender der Jüdischen Kultusgemeinde »Beit Tikwa«.