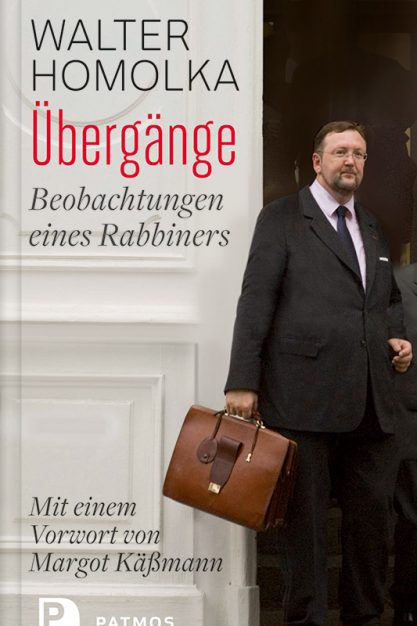Wenn es um den Dialog der Religionen geht, ist er ein gefragter Gesprächspartner: Walter Homolka, 1964 in Bayern geboren, ist der Gründungsrektor des ersten Rabbinerseminars in Deutschland nach der Schoa. Vor nunmehr 20 Jahren, im Juni 1997, wurde er am Leo Baeck College in London zum Rabbiner ordiniert.
Umbruch Was Walter Homolka zum interreligiösen Dialog motiviert und wie es seiner Auffassung nach um Gegenwart und Zukunft der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland bestellt ist, bringt er in seinem neuen Buch Übergänge zu Papier. Der Titel deutet es bereits an: Die Religionen und ihre Erscheinungsformen befinden sich aktuell in einer Phase des Umbruchs. Das mag man mit Sorge oder mit Gelassenheit sehen, spannend bleibt es auf jeden Fall.
Eine von Homolkas zentralen Thesen lautet: »Die große Leistung des Judentums ist es, sich immer wieder selbst neu erfunden zu haben und nicht zu erstarren.« Genau das übt wohl nicht nur auf ihn eine große Faszination aus. Darüber hinaus besitzt das Judentum nach Homolkas Überzeugung einen wichtigen ethischen und moralischen Impetus, der auf die Überwindung von Ausbeutung und Tyrannei abzielt und dadurch einen starken emanzipatorischen Kern enthält.
Auch darum ist es für ihn eine Religion, die auf die Herausforderungen der Moderne viele Antworten zu geben vermag: »Das Judentum betrachtet die Taten eines Menschen als wichtigsten Ausdruck religiösen Lebens und legt auf sie mehr Wert als auf Glaubensbekenntnisse.«
Abraham Geiger Nicht ohne Grund bezieht sich Walter Homolka in seinen Ausführungen immer wieder auf Abraham Geiger (1810–1874), den Begründer der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin und zugleich wichtigsten Vordenker des Reformjudentums – heute eine der vier relevanten Strömungen im Judentum. Sein Grundsatz hieß: »Durch Wissen zum Glauben«.
An diese durch den Nationalsozialismus in Deutschland zerstörten Traditionen wollte Homolka 1999 mit dem nach dem jüdischen Gelehrten aus dem 19. Jahrhundert benannten Rabbinerseminar anknüpfen und sie mit neuem Leben füllen – also den Faden gleichsam wiederaufnehmen. Und mit der 2013 an der Universität Potsdam eröffneten School of Jewish Theology, wo Homolka als Ordinarius für Religionsphilosophie der Neuzeit wirkt, konnte auch dank seiner Initiative nach fast 200 Jahren endlich eine alte Forderung nach der Gleichberechtigung der jüdischen Theologie mit den christlichen sowie den Islamstudien erfüllt werden.
Abraham Geiger ist für Homolka in vielerlei Hinsicht ebenfalls der moralische Kompass, wenn es um den Umgang mit anderen Denkrichtungen oder Religionen geht: »Religiöser Pluralismus bedeutet, mit der Koexistenz unterschiedlicher Lesarten fertig zu werden. Dies gilt innerhalb des Judentums, aber auch darüber hinaus. Deshalb ist es dem liberalen Judentum auch wichtig, dass wir die Identität anderer Religionen ehren und anerkennen.«
Margot Kässmann Selbstverständlich sollte das auch umgekehrt gelten. Warum gerade Homolka Kompetenzen hat, den Dialog mit den Vertretern anderer Religionsgemeinschaften zu initiieren und zu pflegen, bringt Margot Käßmann, zurzeit Botschafterin des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Reformationsjubiläum, in ihrem Vorwort auf den Punkt:
»Er ist ein kundiger Gesprächspartner, hat er doch in Vorbereitung seines Rabbinatsstudiums als Jude selbst zunächst protestantische Theologie studiert, drei Jahre bis zum Baccalaureat 1986 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, und danach 1992 am King’s College in London über Rabbiner Leo Baeck und den deutschen Protestantismus promoviert.«
Walter Homolka selbst hat eine Erklärung parat, welche Erfahrungen aus seiner recht unkonventionellen Biografie für ihn als Rabbiner besonders wichtig waren: »In meiner Zeit als Geschäftsführer bei Greenpeace Deutschland habe ich
vor allem gelernt, dass es sich lohnt, sich für das einzusetzen, was man richtig findet.«
Walter Homolka: »Übergänge. Beobachtungen eines Rabbiners«. Mit einem Vorwort von Margot Käßmann. Patmos, Ostfildern 2017, 208 S., 18 €