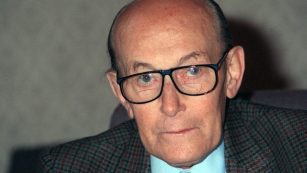Herr Foer, seit rund zwei Wochen wacht die Welt mit immer neuen Tweets des US-Präsidenten Donald Trump auf. Wie fühlt es sich jetzt an, Amerikaner zu sein?
Es ist mir gerade selbst nicht klar, was das bedeutet. Alles verändert sich derart schnell. Das ist sehr befremdlich und beunruhigend. Und wer weiß, wie es in ein paar Tagen sein wird? Amerikaner zu sein, fühlt sich jetzt anders an als vor einer Woche, als vor einem Monat. Was ich sagen kann, ist, dass es sich nicht gut anfühlt – es ist sehr beängstigend.
Bürger von sieben mehrheitlich muslimischen Ländern dürfen für einen begrenzten Zeitraum nicht mehr in die USA einreisen. Wie haben Sie reagiert, als Sie davon erfahren haben?
Zum einen wollte ich sofort losweinen. Es hat mich emotional richtig tief getroffen – nicht nur auf einer intellektuellen oder politischen Ebene. Zum anderen dachte ich mir gleich: Das hält auf keinen Fall stand, die Menschen werden sich dem widersetzen, was sie dann auch getan haben. Ich war bei der Demonstration in New York und habe niemals zuvor so viele Leute an einem Ort gesehen. Das war gut, aber es gab dabei auch diesen winzigen narzisstischen Aspekt: Die Menschen machten Selfies, hatten lustige Posen – es war ein klein wenig wie Halloween. Als Gemeinschaft denken wir gerade über die richtigen und effektivsten Ausdrucksformen nach, um unseren Widerstand zu bekunden. Wenn ich das Wort Gemeinschaft verwende, dann müssen wir uns daran erinnern, dass über drei Millionen Menschen Hillary Clinton gewählt haben. Und einmal ganz abgesehen von der Tatsache, dass die Wahl beeinflusst wurde und Hillary keine gute Kandidatin war – sie wäre eine tolle Präsidentin gewesen, aber politischer Kandidat zu sein, bedeutet auch, die Menschen dazu zu bringen, das zu kaufen, was man anzubieten hat. Selbst wenn das Mist ist.
Und Trump war besser?
Er war ein guter Kandidat, weil er die Leute davon überzeugt hat, das zu kaufen, was er anzubieten hatte. Also: Auch wenn Trump ein guter Kandidat war und auch, wenn die Wahl durch die Russen beeinflusst wurde, hat Clinton trotzdem gewonnen – was die Zahl der Wählerstimmen angeht.
In welche Richtung entwickeln sich die USA?
Ich denke, dass sich Amerika dennoch nach links und nicht nach rechts bewegt. Die demografischen Umfragen sprechen für Hillary – es gibt mehr und mehr junge Menschen, die eine College-Ausbildung haben, die in Städten leben und mehr als nur Englisch sprechen. Die demografischen Erhebungen für Trump sehen schlecht aus, aber er hat nun einmal gewonnen. Außerdem müssen wir Wege finden, mit dieser Realität umzugehen. Wir dürfen unsere Hände nicht über den Kopf zusammenschlagen und »Amerika ist tot« oder »Die Welt ist verloren« rufen. Vielleicht haben wir in vier Jahren einen Zustand erreicht, der besser ist, als wenn Hillary gewählt worden wäre. Manchmal braucht es ein solches Ergebnis, um Menschen politisch aktiv werden zu lassen – nur die Hälfte der Amerikaner geht überhaupt wählen.
Was erwarten Sie von den amerikanischen Juden?
Juden haben eine besondere Verantwortung. Biblisch, wenn Sie so wollen, aber auch aus der Geschichte heraus. Man sollte den Fremden und den Versklavten erkennen. Davon sprechen wir jedes Jahr zu Pessach – die konstante Bewegung auf die Freiheit zu, nicht nur unsere eigene Freiheit. Glücklicherweise passiert das, denn Juden haben unverhältnismäßig oft für Hillary Clinton gestimmt und sind bei den Demonstrationen ganz vorne dabei.
Am 15. Februar wollen sich Donald Trump und Benjamin Netanjahu in Washington treffen. Was erhoffen Sie sich von dieser Zusammenkunft?
Ich denke, dass es ein schrecklicher Fehler für Israel ist, sich mit Trump zu verbünden. Auf lange und auf kurze Sicht. Trump wird abgelöst werden. Und das von jemandem, der auf den »Trumpismus« antwortet. Sich von der globalen Gemeinschaft zu entfremden, sich komplett jemandem anzuschließen, der keine Zukunft hat, ist nicht weise. Man kann viele Ängste und das Misstrauen Israels gegenüber den Vereinten Nationen oder Europa nachempfinden. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass es nicht gut ist, neue Siedlungen zu genehmigen. Mit ihnen gibt es keinen Frieden.
Bei einer Lesung in der Schweiz haben Sie über den israelischen Traum gesprochen. Wie ist es darum bestellt?
Diesen Traum hatte eine Bevölkerung, die langsam weniger wird. Mehr als die Hälfte der israelischen Kindergartenkinder sind israelische Araber oder ultraorthodox. Keine dieser Gruppen hatte den Traum, auf den ich mich bezogen habe. Das Land wurde auf sozialistischen Ideen erbaut. Und langsam ähnelt es immer mehr einem fundamentalistischen Staat. Ich war genau in dem Sommer in Israel, als sich viele internationale Musiker entschlossen hatten, ihre Tour abzusagen. Einerseits könnte man denken: Was soll’s? Andererseits macht es den jungen Menschen doch eine ganze Menge aus. Man kann seine Politik nicht nach ausländischen Künstlern richten, aber man muss zumindest sehen, dass man einen Preis dafür zahlt, wenn man sich von der globalen Gesellschaft entfremdet. Juden haben die Wahl: Sie müssen nicht in Israel leben. Ich könnte in dem Land leben, habe mich aber dagegen entschieden. Israel wird ohne mich überleben. Aber was, wenn Gleichgesinnte in Israel sagen »Das will ich nicht mehr, das Land repräsentiert mich nicht mehr«?
Unter welchen Umständen würden Sie nach Israel ziehen?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich mag das Land, ich fahre gern dorthin und habe eine besondere Beziehung zu Israel, die sich von der unterscheidet, die ich zu anderen Orten habe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dort zu leben. Das könnte ich übrigens auch nicht in Portugal – und ich habe nichts gegen Portugal. Ich mag es einfach, in den USA zu leben.
Sie haben den Titel Ihres neuen Buches »Here I Am« als einen paradoxen Zustand beschrieben. Befindet sich die Gesellschaft gerade in einer solchen Phase?
Ich denke, dass es ein menschlicher Zustand ist. Vielleicht ist das etwas übertrieben: Aber es steht nun einmal so in der Bibel. Es ähnelt dem Bild Abrahams. Er hatte diese miteinander konkurrierenden Identitäten: nämlich ein Mann Gottes zu sein und ein Vater. Es gibt verschiedene Versionen davon, aber es sind unterschiedliche Varianten der gleichen Sache. Es ist nicht nur schwierig, sondern schier unmöglich, sein ganzes Leben hindurch nur eine einzige Seite der Persönlichkeit zu leben. Jeder trägt viele verschiedene in sich.
Sie haben sich mit »Here I Am« nach zehn Jahren wieder mit einem Roman zurückgemeldet. Warum so spät?
Das Buch zu schreiben, hat zwei oder drei Jahre gedauert, damit anzufangen, hat noch einige Zeit mehr in Anspruch genommen, denn es ist viel Leben »dazwischengekommen«. Ich habe zwei Kinder, habe Eating Animals geschrieben und kleinere Sachen. Aber der eigentliche Grund war: Es gab nichts, worüber ich schreiben wollte. Ich fühle mich nicht verpflichtet, alle paar Jahre ein Buch zu schreiben. Davon werden weder die Welt noch ich besser. Ich möchte über Dinge schreiben, die mir wichtig sind.
Könnten Sie sich vorstellen, ein Buch über die jetzige politische Situation in den USA zu schreiben?
Ja, das wäre durchaus inspirierend. Ob man die Situation nun anerkennt oder auch nicht. Es ist das Wasser, in dem wir schwimmen.
Wie nehmen Sie die Geschehnisse in Europa wahr?
Europa ist beängstigender für mich als Amerika.
Weshalb?
Die nationalistischen Tendenzen sind viel stärker ausgeprägt. Antisemitismus und Islamophobie äußern sich viel deutlicher – auch in Form von Gewaltakten: ob es nun darum geht, Synagogen zu zerstören oder Einwanderer zu attackieren. Europa ist auf dem Weg zu einer komplett anderen Ideologie, und ich denke, dass das in den USA nicht passiert. Der Wahlkampf war ein Wettkampf der Persönlichkeiten. Allerdings kann ich mich auch irren.
Mit dem Schriftsteller sprach Katrin Richter.