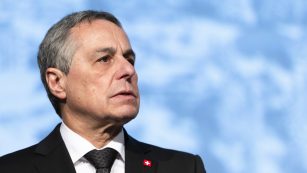Der Sprengsatz war in einer Plastiktüte versteckt: Am 27. Juli 2000 gegen 15.04 Uhr explodiert am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn eine Rohrbombe und richtet ein Blutbad an. Metallsplitter fliegen bis zu 100 Meter weit, einer durchbohrt ein ungeborenes Baby im Bauch seiner Mutter und tötet es. Unter den zehn Verletzten sind mehrere jüdische Einwanderer aus Osteuropa.
In der Folgezeit des weltweit beachteten Anschlags schnellen die rechtsradikalen Straftaten in Deutschland in die Höhe. 25 Jahre später steigen sie wieder in die Höhe – und immer noch ist unklar, wer die Bombe gelegt hat. Für viele ist das schmerzhaft wie eine offene Wunde.
Zum 25. Jahrestag des Wehrhahn-Anschlags am 27. Juli ist eine Gedenkveranstaltung geplant, unter anderem mit der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW, Sylvia Löhrmann.
Freispruch rechtskräftig
Der Rechtsradikale, der wegen des Anschlags erst viele Jahre später vor Gericht kam, hat inzwischen einen rechtskräftigen Freispruch in der Tasche. 2021 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) den Freispruch des Landgerichts von 2018 bestätigt.
Der Freispruch sei rechtsfehlerfrei begründet, sagte der Vorsitzende BGH-Richter Jürgen Schäfer bei der Urteilsverkündung. Die Beweiswürdigung sei grundsätzlich Sache des Tatrichters und vom BGH hinzunehmen - selbst in Fällen, in denen ein anderer Schluss nähergelegen hätte.
Im Gegensatz zum Landgericht hatte der damalige Oberstaatsanwalt Ralf Herrenbrück keine Zweifel an der Täterschaft des Rechtsradikalen, für den er wegen »erdrückender Beweislage« lebenslange Haft beantragt hatte. Heute hat er wenig Hoffnung, dass der Fall noch einmal aufgerollt werden könnte.
Fingerabdrücke verdampft
Fingerabdrücke oder DNA-Spuren waren durch die Hitze der Explosion buchstäblich verdampft. Anders als in vielen Cold Cases gebe es daher keine eindeutigen Spuren. »Es bräuchte daher schon ein Geständnis oder eine Zeugenaussage mit Täterwissen, womit nach dem Ablauf von 25 Jahren prognostisch eher nicht mehr zu rechnen ist«, sagte Herrenbrück der Deutschen Presse-Agentur.
1500 Menschen wurden wegen des Wehrhahn-Anschlags befragt, mehr als 300 Spuren verfolgt, 450 Beweisstücke eingesammelt. Ein Militaria-Händler, der in der Nähe wohnte, geriet schon bald ins Visier der Ermittler, wird aber auch schnell wieder freilassen. Später werden Ermittlungsfehler bekannt: Ausgerechnet die erste Durchsuchung bei ihm sei eher ein »Stuben-Durchgang« gewesen, kritisierte ein Ermittler.
Die Ermittlungen verlaufen im Sand. Doch dann gibt ein Gefangener in einem NRW-Gefängnis zu Protokoll, ein Mithäftling habe ihm gegenüber damit geprahlt, er habe »an einem Bahnhof Kanaken weggesprengt«.
Indizien-Prozess
Der Mithäftling ist jener rechtsradikale Militaria-Händler. Die Sprachschule, in die die Opfer gingen, lag gegenüber seinem Laden, und es hatte zuvor Ärger gegeben zwischen Sprachschülern und der Skinhead-Kundschaft seines Ladens.
Das brachte die Ermittlungen um den Bombenanschlag nach Jahren wieder in Gang. Sie mündeten in einen Indizien-Prozess. Doch das Gericht schenkte dem Mithäftling später genauso wenig Glauben wie den Ex-Freundinnen des Angeklagten, die ausgesagt hatten, er habe dunkle Ankündigungen gemacht. Eine will sogar die Bombe in der Wohnung des Verdächtigen gesehen haben.
Zwei Jahre nach dem Anschlag war in einem Wohnmobil am Düsseldorfer Rheinufer Sprengstoff vom Typ TNT sichergestellt worden – und eine Schachtel für sechs elektronische Zünder – ein Zünder fehlt. Es ist das Wohnmobil eines Bekannten des verdächtigen Militaria-Händlers.
Zünder in Wohnung
Die Bedienungsanleitung für den Zünder fand sich nach dem Anschlag in seiner Wohnung. Eine Zeugin hatte bei der Detonation einen Mann am Tatort auf einem Stromkasten sitzen sehen, der nach der Explosion verschwand und dem damaligen Angeklagten ähnelte.
»Die Ähnlichkeit belastet den Angeklagten am stärksten«, stellte der Richter fest. Für eine Verurteilung reiche das alles aber nicht, auch wenn der Fremdenhass des Angeklagten gut belegt sei und er ständig gelogen habe.
Für die Opfer habe der Anschlag das Leben von einer Sekunde auf die andere verändert, bemerkte der BGH-Richter vor vier Jahren. Viele litten immer noch unter den Folgen.