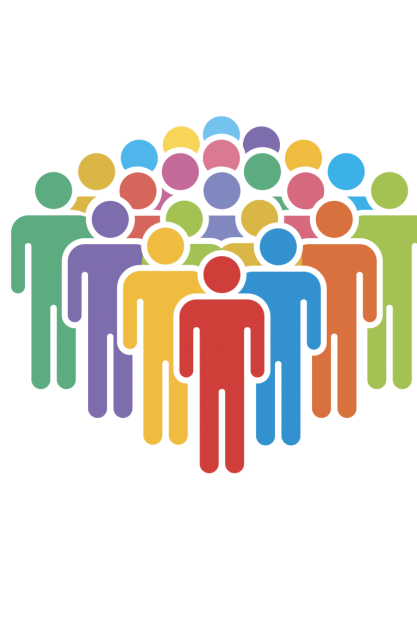Jüd*innen passen nur selten in Schubladen. Das wird besonders deutlich, wenn es darum geht, wie diskriminierende Erfahrungen beschrieben und eingeordnet werden. Akademische und vermeintlich gut gemeinte Debatten zeigen hier nicht selten eine Distanz zu Erfahrungen, die Jüd*innen in ihrem Alltag machen.
In seiner Kolumne in der Jüdischen Allgemeinen vom 5. Dezember 2019 nahm Michael Wuliger Bezug auf einen Artikel, den Ferda Ataman für Spiegel-Online geschrieben hatte. Ataman bezeichnet darin Jüd*innen als PoC, People of Colour. Wuliger schließt mit seinen Gedanken zur »Farbigkeit« der jüdischen Gemeinschaft daran an. In seiner Polemik unterlässt Wuliger es jedoch, eine interessante und wichtige Diskussion zu führen. Denn es gibt sie tatsächlich, die Jüd*innen, die sich als PoC identifizieren.
Jüd*innen sollten sich Bewusst am Diskurs um Intersektionalität beteiligen und ihre Erfahrungen einbringen.
Das liegt freilich nicht an ihrer Hautfarbe, sondern daran, dass sie regelmäßig erleben, wie eine weiße, christlich dominierte Mehrheitsgesellschaft sie ausschließt. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Bevor sie sich als Jüd*innen zu erkennen geben, können sie erleben, dass sie diskriminiert werden. Etwa deswegen, weil sie nicht flüssig deutsch sprechen, oder, weil sie durch ihr Aussehen auffallen, das als »anders« gekennzeichnet wird.
INTERSEKTIONALITÄT So kommen unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen zusammen. Dieses Konzept wird als Intersektionalität beschrieben. Das bedeutet für Jüd*innen, dass sich der Antisemitismus, den sie erleben, mit anderen Ausgrenzungserfahrungen etwa aufgrund ihrer Herkunft, Geschlechtsidentität oder ihrer sexuellen Orientierung verbindet. Dies kann in und außerhalb der jüdischen Community geschehen.
Es gibt nur ein Problem bei der Sache: Die traditionelle Theorie der Intersektionalität geht von dem Dreiklang »race«, »class« und »gender« aus. Damit kann das Konzept Antisemitismus nicht erklärt werden. Gruppen, die eigentlich Schutz vor genau dieser Erfahrung bieten wollen, vermögen das zum Teil nicht, weil sie Antisemitismus nicht als eigenständiges Phänomen wahrnehmen. Der Hass auf Juden wird lediglich als ein weiteres Vorurteil unter vielen angesehen. Damit wird allerdings die Struktur und die Funktion des Antisemitismus vollkommen verkannt.
Michael Wuliger macht in seiner Kolumne wiederholt klar, dass die Zwischenräume, in denen sich so viele jüdische Menschen in ihren Lebensrealitäten bewegen, seinen Horizont sprengen.
Israel wird zu einem rassistischen Apartheidstaat erklärt, Phänomene werden miteinander vermischt und klare Abgrenzungen zwischen Gut und Böse erzeugt. Jüd*innen werden als »weiß« definiert, PoC oder Muslima* zu den »neuen Jüd*innen« erklärt.
Es sind diese Diskussionen, in denen progressive jüdische Personen hilflos bleiben. Unter dem Dach eines vermeintlich diskriminierungsfreien Raumes, ist es ihnen unmöglich, ihre Erfahrungen mit Diskriminierung zum Ausdruck zu bringen. Ihre Stimmen bleiben ungehört. Es ist daher wichtig, dass wir uns nicht aus diesen Debatten zurückziehen, sondern dass wir sie aktiv gestalten. Wir müssen jüdische Perspektiven einbringen und ein differenzierteres Verständnis von Antisemitismus als Teil intersektionellen Denkens vermitteln.
QUEERS In einem großen Teil der säkularen jüdischen Gemeinschaft besteht der Wunsch, im mehrheitsgesellschaftlichen Umfeld dazuzugehören. Diejenigen, die nicht auffallen, solange sie sich nicht als Jüd*innen zu erkennen geben, können häufig nicht verstehen, warum es innerhalb der jüdischen Community Personen gibt, die sich selbst noch etwas anderes ‚auflabeln‘. Sie verstehen nicht, warum es anderen Jüd*innen wichtig ist, dass sie auch als Frauen*, als Queers, als Person mit Migrationsbiografie, als, als, als ... wahrgenommen werden.
Hinter dem Unverständnis für diese Bezeichnungen steckt häufig die Uneinigkeit darüber, wann die jüdische Community als Gemeinschaft am stärksten ist: Sollten wir uns an Diskursen beteiligen, die nur wenige von uns betreffen? Nehmen wir die unterschiedlichen Erfahrungen wahr, die Mitglieder unserer Gemeinschaft machen? Büßen wir an gemeinsamer Identifikation ein, wenn wir auch Unterschiede sichtbar machen?
ERFAHRUNGEN Die Diskussion darüber, ob Jüd*innen PoCs sind, sollte nicht verschenkt werden. Sie sollte auch nicht nur von denjenigen geführt werden, die den Begriff nur googlen, um ihn dann zu zerreißen. Nicht, weil Jüd*innen so dringend ein weiteres ‚Label‘ brauchen, sondern weil Polemik nicht der einzige Einstieg in einen so wichtigen Diskurs sein darf.
Wer die jüdische Community in ihrer Vielfalt darstellen will, braucht Empathie, und keine kurze, oberflächliche Wikipedia-Recherche.
Gerade, weil es ein Diskurs ist, von dem wir als Jüd*innen ohnehin zu häufig ausgeschlossen werden. Außerdem klammert dieser Blick die Diversität und die vielfältigen Erfahrungen unserer Gemeinden aus. Denn es gibt Jüd*innen, die nicht nur Antisemitismus erleben. Wo ist Platz für die Erfahrungen unserer äthiopischen und jemenitischen, unserer sephardischen und mizrachischen, unserer bucharischen und unserer queeren Gemeindemitglieder?
Michael Wuliger macht in seiner Kolumne wiederholt klar, dass die Zwischenräume, in denen sich so viele jüdische Menschen in ihren Lebensrealitäten bewegen, seinen Horizont sprengen. Er polemisiert über sprachinklusive Maßnahmen, wie etwa das Gender-Sternchen oder veremintlich irreführende Akronyme wie LGBTQI und PoC. Es sei so anstrengend, was jetzt ‚auf einmal‘ alles berücksichtigt werden müsse. Ganz so, als ob die Vielfalt an Perspektiven und Erfahrungen, die beispielsweise auch das Leben in Israel seit jeher kennzeichnen, plötzlich aus dem Karton gesprungen wären.
Als jüdische Gemeinden sind wir bunt, vielfältig und offen.
Manchmal sollten wir, statt uns in Floskeln zu üben, nachdenken: Wer bestimmt den Diskurs zu ganz bestimmten Themen? Warum werden die Urteile und Bewertungen älterer Herren in der Regel nicht hinterfragt und im Gegenteil die Ignoranz als Akt der Widerständigkeit beklatscht? Wo sind die Stimmen von weniger etablierten Personen, die sich immer wieder rechtfertigen müssen, wenn ihre Haltung die normative Ordnung in Frage stellt?
VIELFALT Vielfältige Perspektiven können uns neue Mittel im Kampf gegen Antisemitismus liefern und uns zu Mitgliedern einer Gesellschaft machen, die wachsam ist und das nicht nur, wenn es um uns selbst geht. Sie können helfen, ein realistisches Bild unserer Gemeinschaft aufzuzeigen. Dazu gehört, vielfältige Identitäten sichtbar zu machen.
Wir brauchen nicht gegen andere marginalisierte Gruppen in der Gesellschaft zu treten. Wer die jüdische Community in ihrer Vielfalt darstellen will, braucht Empathie, und keine kurze, oberflächliche Wikipedia-Recherche.
Laura Cazés ist Referentin für Verbandsentwicklung bei der ZWST und Monty Ott ist Vorsitzender von Keshet Deutschland e.V.