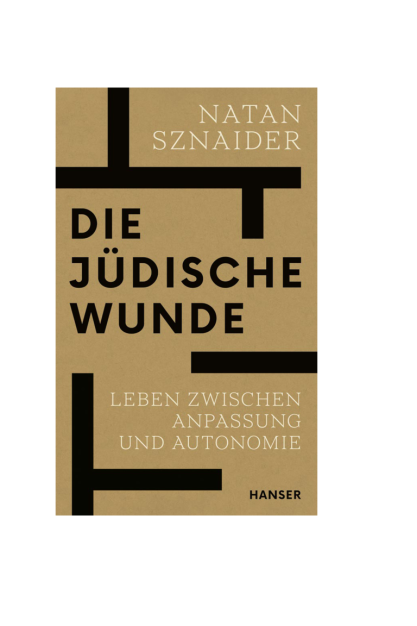»Jüdisches Leben in Deutschland – Die unbekannte Welt nebenan«: Auf dem irritierenden Cover des Sonderhefts Geschichte des Nachrichtenmagazins »Der Spiegel« wurden 2019 vor einem großen Davidstern zwei orthodoxe Juden abgebildet. In seinem neuen Buch Die jüdische Wunde gibt der in Tel Aviv lebende Soziologe Natan Sznaider, in Mannheim als Sohn zweier Schoa-Überlebender geboren, einem der beiden »Spiegel«-Coverhelden einen Namen – nämlich Nathan.
Ihn setzt Natan, der Buchautor, ins Verhältnis zu einem dritten Namensvater, dem Protagonisten von Gotthold Ephraim Lessings Klassiker Nathan der Weise. Während die Orthodoxen allein schon optisch für die Tradition der Ostjuden, Modernitätsverweigerung und damit für Partikularismus stehen, verkörpert Lessings Nathan eine Figur der Aufklärung und den Eintritt in eine Ära des Universalismus, die im Namen der Gleichheit zudem die Aufgabe ihrer Sichtbarkeit als Juden einfordert. Dass die daraus resultierende Assimilation und die viel beschworene deutsch-jüdische Symbiose eine ziemlich einseitige Angelegenheit sein sollte, zeigte spätestens das Jahr 1933.
Zur Veranschaulichung nimmt Sznaider die Dankesrede von Hannah Arendt, die 1959 in Hamburg den »Lessing-Preis« erhielt, genauer unter die Lupe. Als nunmehr amerikanische Jüdin, die in Deutschland geboren wurde, zweimal vor den Deutschen fliehen musste und das Thema Selbstbehauptung aus eigener Lebenserfahrung bestens kennt, wendet sie sich an ein postnazistisches Publikum. Und während die Deutschen gern etwas von Versöhnung und Vergebung gehört hätten, verweigert sie sich diesem Wunsch. Arendt macht die Juden in Hamburg wieder sichtbar: »Und über allem schwebt die Figur des weisen Nathan.«
Hannah Arendts Hamburger Rede 1959 ist Dreh- und Angelpunkt des Buches
Hannah Arendts Hamburger Rede ist Dreh- und Angelpunkt des Buches. Pikant aber ist der Hintergrund der Preisverleihung: Denn eigentlich wollte man in Hamburg 1959 statt Arendt den Kunsthistoriker Werner Haftmann ehren. Dieser zeichnete 1955 und 1959 für die ersten documenta-Ausstellungen in Kassel verantwortlich, war ein SA-Mann der ersten Stunde und während des Zweiten Weltkriegs an der blutigen Partisanenbekämpfung in Italien beteiligt. Haftmann musste nur drei Jahre warten, dann bekam auch er den Lessing-Preis.
Wer Trost oder zumindest etwas Zuspruch sucht, findet Letzteren vielleicht in einem Zitat von Hannah Arendt.
Der documenta-Macher formulierte, wie Sznaider unterstreicht, nicht nur eine »These von der abstrakten Kunst als einer Art vorurteilsfreiem Akt des Erblebens«, die ohne Geschichte und Kontext daherkommt und allenfalls die »Reinheit der Linien« betont. Jüdische Künstler werden darin, wie auf den ersten documenta-Ausstellungen, ausgeschlossen – Marc Chagall ist die Ausnahme von der Regel.
Mehrdeutigkeit wurde auch auf der documenta fifteen nicht mehr zugelassen
»Abstrakte Kunst, der Inbegriff von Mehrdeutigkeit, wird in der postnationalsozialistischen Weltanschauung von Werner Haftmann und seinen Kollegen bei den ersten beiden Ausgaben der documenta durch den Ausschluss der traumatisierten Vergangenheit und den Ausschluss von Juden und Jüdinnen auf Eindeutigkeit reduziert«, konstatiert Sznaider – ein Vorgang, der unter anderen Vorzeichen 2022 in Kassel reproduziert wurde und für Antisemitismusskandale in Serie sorgte. Mehrdeutigkeit war etwas, was auch auf der documenta fifteen nicht mehr zugelassen wurde. Ähnlich verlaufen manche Debatten um Israel, erst recht nach dem 7. Oktober.
Auch das Konfliktfeld, das sich aus dem Verhältnis zwischen partikularer und universalistischer Identität ergibt, ist weiterhin existent: »In der Staatlichkeit Israels manifestiert sich nicht nur die Spannung zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, Heiligkeit und Souveränität der jüdischen Existenz«, befindet Sznaider. »Die Souveränität macht das Jüdische wieder sichtbar, obwohl der politische Zionismus vom aufklärerisch inspirierten Impuls der Unsichtbarkeit ausging, die Juden wie alle anderen Völker werden zu lassen.« In seinem tendenziell hoffnungslosen Buch versucht Natan Sznaider nicht, Widersprüche aufzulösen, sondern plädiert dafür, sie zu ertragen.
Für die »jüdische Wunde« gibt es kein Pflaster. Wer Trost oder zumindest etwas Zuspruch sucht, findet Letzteren vielleicht in dem vorangestellten Zitat von Hannah Arendt: »Judesein gehört für mich zu den unbezweifelbaren Gegebenheiten meines Lebens, und ich habe an solchen Faktizitäten niemals etwas ändern wollen. Eine solche Gesinnung grundsätzlicher Dankbarkeit für das, was ist, wie es ist, gegeben und nicht gemacht, physei und nicht nomoi, ist präpolitisch.«
Natan Sznaider: »Die jüdische Wunde. Leben zwischen Anpassung und Autonomie«. Hanser, München 2024, 272 S., 26 €