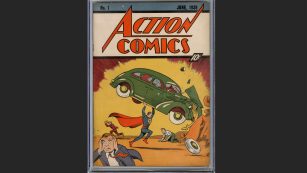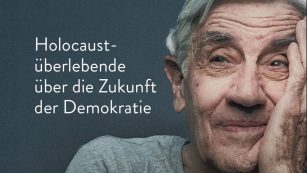Der Weg zum Frieden ist lang. »We are looking for peace«, sagen zwei Besucher des Messestands des Israeli Institute For Hebrew Literature. Er sei aus dem Libanon, sagt einer der beiden. Händedrücke werden ausgetauscht, die libanesischen Messebesucher ziehen weiter. Wir sind auf der Frankfurter Buchmesse, am hinteren Ende der Halle 6.0, die vor allem Verlage aus der angelsächsichen Welt beherbergt.
Ziemlich versteckt wirkt der von den israelischen Ministerien für Kultur und Auswärtiges geförderte Stand, der israelische Schriftsteller mit Vertretern der Verlagsbranche, Übersetzern und Journalisten in Kontakt bringen soll. »Es ist mein erstes Mal hier auf der Frankfurter Buchmesse«, sagt Yossi Avni-Levy. Der Schriftsteller und Diplomat läutet am Donnerstagmittag eine zweitägige Gesprächsreihe ein, bei der Autoren aus Israel über ihre bislang noch nicht ins Deutsche übersetzten Werke sprechen.
Avni-Levy erzählt, er habe über Jahre hinweg immer dasselbe Buch geschrieben: »Im Mittelpunkt der Geschichte stand ein einsamer schwuler Kerl auf der Suche nach Liebe.« Eine berufliche Station in Litauen brachte den Sohn jüdischer Einwanderer aus Iran und Afghanistan dann dazu, ein Buch über die Schoa zu schreiben. »Es ist ein Teil von mir – als Jude, als Israeli und als Mensch«, sagt Yossi Avni-Levy über den Völkermord an den europäischen Juden.
Sein 2023 erschienenes Buch »Three Days in Summer« handelt von einem fiktiven, »zwischen Wäldern und Seen« gelegenen litauischen Shtetl im Sommer 1941. Es gehe um Juden, Litauer, Russen und einen mordenden Nazi auf dem Motorrad, so Avni-Levy. Das Buch ist in drei Kapitel unterteilt, jeder Abschnitt ist einem Tag gewidmet. Es habe märchenhafte Elemente, sei aber ein sehr trauriges Buch.
Mit »Three Days in Summer« gelang Yossi Avni-Levy der Durchbruch auf dem israelischen Buchmarkt
Mit »Three Days in Summer« gelang Yossi Avni-Levy der Durchbruch auf dem israelischen Buchmarkt. Mit dem Brenner Prize und dem Sapir Prize erhielt er zwei renommierte Auszeichnungen für hebräische Literatur. »For me, it was a huge-huge Überraschung«, sagt Avni-Levy in einer Mischung aus Englisch und Deutsch.
Vom Gefangensein im falschen Geschlecht handelt Eran Bar-Gils jüngst erschienener Band »South Line«. Es geht um ein Mädchen, das ein Junge sein will und sich als Jugendliche einer Geschlechtsumwandlung unterzieht. Der zweite Teil des Buches spielt laut Bar-Gil wenige Jahre später, als der Protagonist Omer bereits Soldat der israelischen Armee ist. Am 7. Oktober 2023 ist er auf Familienbesuch in einem Kibbuz im Süden Israels. Omer geht nach draußen, um den Ort zu verteidigen, während seine Freunde auf dem Nova-Festival tanzen.
»Am Ende werden alle getötet, was sehr traurig ist«, verrät Eran Bar-Gil. Für den Protagonisten von »South Line« gehe aber der Traum von Anerkennung in Erfüllung: Obwohl Transgender, werde er in der Armee als Mann behandelt.
Fast zehn Prozent aller 2024 in Israel verlegten Bücher handelten vom 7. Oktober und seinen Folgen, berichtet Generalkonsulin Talya Lador-Fresher bei einem Pressetermin am Donnerstagnachmittag. Israel sei ein »literary powerhouse« – eine literarische Macht, wenn man so will.
Als »a coming-of-age novel, a Bildungsroman« bezeichnet Tamar Raphael ihr 2024 erschienenes Debüt »There Were Two With Nothing to Do«. Darin erzählt die in Berlin lebende israelische Autorin von Yiftach und Ellinor – einem jungen, in einer nicht näher bezeichneten, an Tel Aviv erinnernden Küstenmetropole lebenden Paar, dessen Beziehung während eines nicht näher bezeichneten Krieges zwischen die politischen Fronten gerät. Raphaels Buch handelt von Idealismus und Desillusionierung sowie von ganz normalen menschlichen Schwächen.
Übersetzungsfragen betreffen alle Kulturen
So abstrahiert und universell wie die Anlage ihres Debüts sieht Tamar Raphael auch Fragen literarischer Übersetzung, über die sie mit dem Autor und Verleger Oded Carmeli spricht. Im Hebräischen gebe es unübersetzbare Wörter, die bei einer Übertragung möglichst im Original belassen werden sollten, sagt Carmeli. Solche Übersetzungsfragen beträfen alle Kulturen, sagt Raphael: »Da unterscheidet sich das Hebräische nicht von anderen Sprachen.«
Für unübersetzbar hält Oded Carmeli die hebräische Bezeichnung eines fiktiven Gottes, der in seinem jüngsten Buch »No One Came Or Is Coming Or Ever Will Be« angebetet wird. Diese Weltraum-Gottheit bezeichnet Carmeli im Englischen als »Lord of the Void«. Sein Buch handelt vom Erwachsenwerden.
»Ich wollte immer Astronaut werden«, bekennt der Autor. Alle sagten immer: »Folge deinen Träumen!« Es sei aber nicht möglich, alle Träume zu verwirklichen, mahnt Oded Carmeli. Coming of age bedeute eben, anzuerkennen, dass man ist, wie man ist. Die Realität anerkennen: eigentlich auch ein vielversprechender Ansatz auf dem Weg zum Frieden.
Das Israeli Institute For Hebrew Literature ist auf der Frankfurter Buchmesse in der Halle 6.0, Stand D15 zu finden.