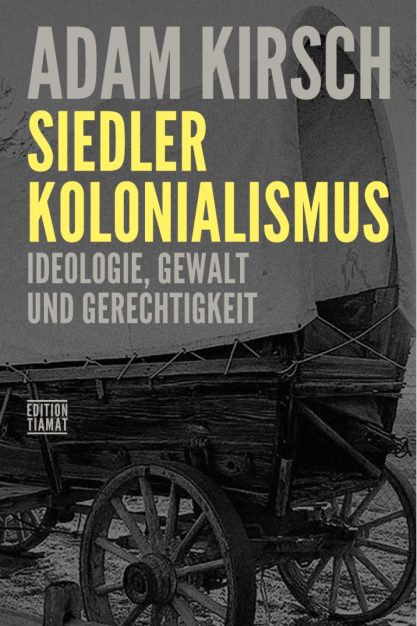»Wenn jemals etwas ein Dokument der Barbarei war, so der Hamas-Angriff vom 7. Oktober; doch der Ideologie des Siedlerkolonialismus schien er lobenswert, weil sie darin einen Versuch sah, historisches Unrecht wiedergutzumachen.« Dieser Satz, geschrieben von Adam Kirsch gegen Ende seines nun auch auf Deutsch erhältlichen Essays Siedlerkolonialismus, bringt die ganze Problematik auf den Punkt: Wie war es möglich, dass noch vor dem Einsetzen des israelischen Gegenschlags die Massaker an israelischen Zivilisten unter Studierenden amerikanischer Elite-Universitäten eine derartige Euphorie auslösen konnten?
Kirsch, in den USA bislang vor allem als Dichter und Literaturkritiker bekannt, liefert Antworten, die aufhorchen lassen, weil es sich keineswegs um ein exklusiv amerikanisches Phänomen handelt. So zeigt er auf, wie gegen Ende des 20. Jahrhunderts eine wissenschaftliche Disziplin entstand, die Erkenntnisse der Kolonialismusforschung in bizarrer Form aus- und überdehnte. Denn der Begriff »Siedlerkolonialismus« hatte ursprünglich durchaus seine Berechtigung. Er unterschied jene Kolonien, in denen eine kleine Zahl europäischer Verwaltungsbeamte wirkte, die aber nur temporär vor Ort lebten, von Südafrika oder Rhodesien, wo Europäer sich niederließen und einen sich selbst privilegierenden Minderheitenanteil an der Gesamtbevölkerung bildeten.
Rückabwicklung einer jahrhundertelangen Entwicklung
Indem nun aber vorab australische und amerikanische Forschende diesen Begriff auch auf ihre eigenen Staaten anwandten, wo die indigene Bevölkerung zu einer kleinen Minderheit geschrumpft war, forderten sie praktisch die Rückabwicklung einer jahrhundertelangen Entwicklung.
Statt die Indigenen für das ihnen angetane Unrecht zu entschädigen, verwandelte diese an Universitäten zusehends raumgreifende Ideologie die Mehrheitsbevölkerung und alle ihre Nachkommen, selbst jene der einst unter Zwang eingereisten Sklaven, in »Siedler« und verherrlichte die ursprüngliche, weil angeblich authentische Kultur, die sie zerstört hätten.
Statt faktische Verbesserungen herbeizuführen, geht es diesen Ideologen, die dabei laut Kirsch puritanischen Mustern folgen, darum, »die eigene Verdammnis zu akzeptieren, was zu einem gewissermaßen paradoxen Stolz auf die Anerkennung der Schuld führt«. Es sollte noch eine Weile dauern, bis die Vertreter dieser Strömung ein Land identifizierten, in dem zwar die Realität eine völlig andere ist, auf das aber ihre Ideologie insofern anwendbar schien, als man darauf vertraute, den dortigen Kolonisten tatsächlich den Garaus machen zu können, und zwar Israel.
Dass ausgerechnet Juden als zu beseitigende »Siedlerkolonialisten« identifiziert wurden, machte das Ganze umso interessanter und seit dem 7. Oktober 2023 geradezu attraktiv. Aber auch bei den Palästinensern machte sich mit der Konjunktur dieser Denkrichtung eine Änderung bemerkbar: Wehrten sie sich früher energisch dagegen, als »Indigene« und somit historische Verlierer bezeichnet zu werden, gibt es neuerdings Anreize, sich genau dieses Etikett anzuheften.
Der Begriff des Indigenen
Der Begriff des Indigenen selbst, so zeigt Kirsch, generiert eine Art Nullsummenspiel, und zwar letztlich überall. Denn keine Gruppe war immer schon an einem Ort anwesend, ohne dass vorher Ansässige nicht irgendwann vertrieben oder getötet worden wären. Im historischen Land Israel betraf das ja einst auch die Juden selbst.
Kirsch seziert die Mechanismen einer ideologiegetriebenen Wissenschaftsrichtung, die sich selbst in den Dienst einer real angestrebten Vernichtung des als »siedlerkolonialistisch« denunzierten Israel stellt und vor allem in der angelsächsischen Welt zusehends wirkungsmächtig wird, wenn es um die Gestaltung von Selbst- oder Fremdbildern geht.
Adam Kirsch: »Siedlerkolonialismus. Ideologie, Gewalt und Gerechtigkeit«. Aus dem Englischen von Christoph Hesse, mit einem Nachwort von Tim Stosberg. Edition Tiamat, Berlin 2025, 200 S., 24 €