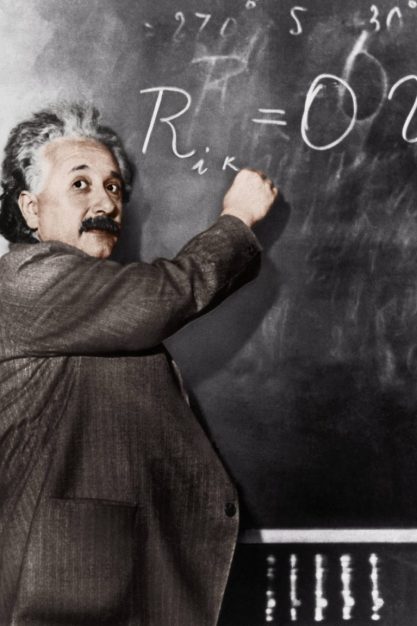Einen ungewohnten Blick auf den großen Wissenschaftler Albert Einstein (1879-1955) bietet das neue Ulmer Museum »Die Einsteins - Museum einer Ulmer Familie«. Die Dauerausstellung, die am 5. Juli geöffnet wird, zeigt die Einbindung des Nobelpreisträgers in eine weitverzweigte jüdische Verwandtschaft, wie das Museum am Mittwoch in Ulm mitteilte. Einstein wurde am 14. April 1879 in Ulm geboren.
Die erste Abteilung des Museums hat die Kindheit des Physikers zum Thema. Sie zeigt neben Zeugnissen der weltweiten Bedeutung Einsteins wie Einstein-Figuren, Zeitschriftenartikel und Briefmarken auch ein originalgetreues Lego-Modell seines Geburtshauses in der Ulmer Bahnhofstraße sowie ein altes Spielzeug, einen Steckkasten für Perlen-Mosaike, aus dem Kinderzimmer der Einsteins.
Ein Schwerpunkt der Ausstellung ist dem jüdischen Leben in Ulm gewidmet. Dazu gehört das dem Museum gestiftete Gemälde des Innenraums der Ulmer Synagoge, die in der Reichspogromnacht 1938 in Flammen gesetzt und dann abgerissen wurde. Mehrere Exponate verdeutlichen den wachsenden Antisemitismus, die Verfolgung der Juden, der auch mehrere Verwandte Albert Einsteins zum Opfer fielen, Flucht und Emigration. Nach der Machtergreifung der Nazis hatte sich Einstein im Dezember 1933 in Princeton/USA niedergelassen.
Die einzelnen Exponate, die zum großen Teil aus der Familie Einsteins stammen, werden durch digitale Medien ergänzt. Wie Kuratorin Sabine Presuhn erläuterte, können sich die Besucher auf Media-Guides Graphic Novels zu wichtigen Persönlichkeiten herunterladen, bei einem virtuellen Rundgang das Ulm zur Zeit Einsteins erleben oder eine historische Straßenbahnfahrt unternehmen.
Die Kosten des Einstein-Museums belaufen sich den Angaben zufolge auf etwa über zwei Millionen Euro, an denen sich die Baden-Württemberg-Stiftung mit 600.000 Euro beteiligt hat. epd