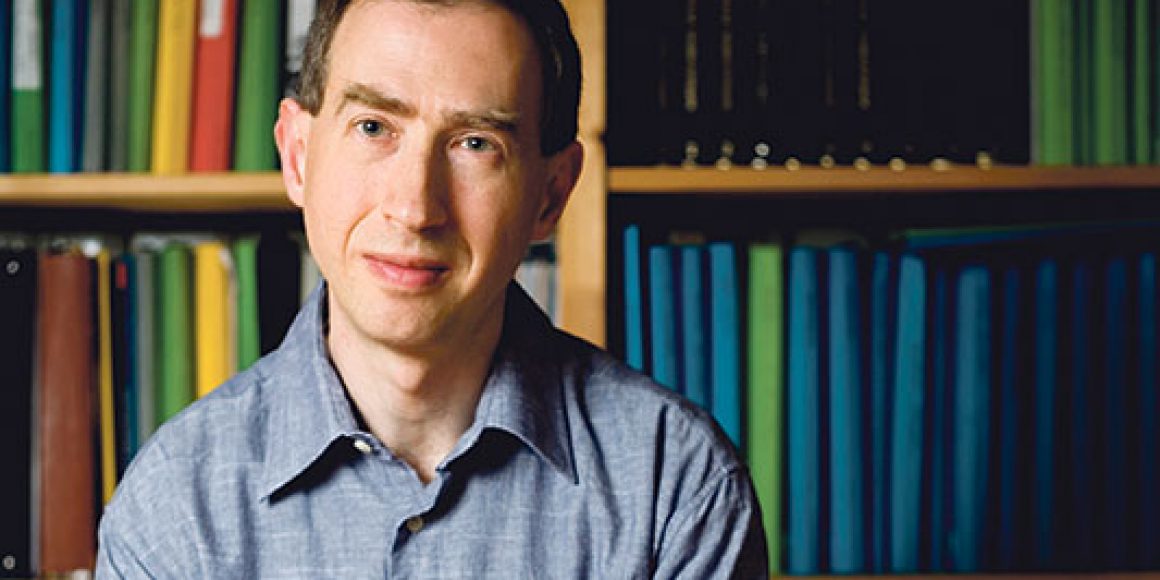Neuer Lehrstuhlinhaber am Institut für Musikwissenschaft der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar ist der Pianist und Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov, zuvor Akademischer Studienleiter des Kantorenseminars des Abraham Geiger Kollegs. Die neu geschaffene Professur für die Geschichte der jüdischen Musik ist der erste voll ausgestattete Lehrstuhl für jüdische Musikgeschichte in Europa.
Für Hochschulpräsident Christoph Stölzl vertritt Nemtsov, der 1963 im sibirischen Magedan geboren wurde, »den Idealtypus des forschenden Musikers beziehungsweise des musizierenden Wissenschaftlers – beide Rollen gehören bei ihm untrennbar zusammen«.
Musikgeschichte Das wurde in seiner Antrittsvorlesung »Musik als geistiger Widerstand« am 3. Dezember im Festsaal des Fürstenhauses in Weimar deutlich: Nemtsov verband seinen Vortrag zur Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts, das vom Totalitarismus geprägt war, mit einem Konzert mit Werken von vier Komponisten, die Opfer des Nationalsozialismus und des Stalinismus wurden und deren Widerstandswille in ihrer Musik zum Ausdruck kommt.
Nemtsov spielte eine Sonate von Gideon Klein (entstanden 1943 in Theresienstadt), das Werk Nigun/Arie von Jakob Schönberg aus der Chassidischen Suite (Berlin 1937) und drei Volkstänze von Alexander Weprik (Moskau 1926). Zum Abschluss brachte er Auszüge aus dem Zyklus 24 Präludien und Fugen von Vsevolod Zaderatsky, die dieser 1937/38 im Gulag in Kolyma komponiert hatte, zur Uraufführung.
Lebenswillen Seinen Vortrag beschloss Jascha Nemtsov mit einem Zitat des Komponisten Victor Ullmann, der 1942 nach Theresienstadt deportiert und 1944 in Auschwitz-Birkenau ermordet wurde: »Zu betonen ist nur, dass ich in meiner musikalischen Arbeit durch Theresienstadt gefördert und nicht etwa gehemmt worden bin, dass wir keineswegs bloß klagend an Babylons Flüssen saßen und dass unser Kulturwille unserem Lebenswillen adäquat war.«
Für das Publikum im voll besetzten Saal (darunter der Fraktionsvorsitzende der Linken im Thüringer Landtag, Bodo Ramelow, und der Berliner Domkantor Tobias Brommann) boten Musik und Vortrag Stoff für ausgiebige Diskussionen.