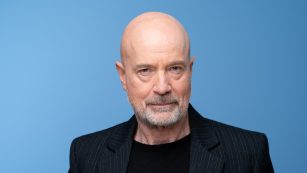Der Blick schweift über herbstliche Natur. Da irgendwo liegt Feldafing, ein beschauliches Örtchen am Starnberger See. Eine Videopanorama-Aufnahme füllt die gesamte Bühnenrückwand der Therese-Giehse-Halle, gibt die Sicht frei auf oberbayerische Landschaft. Später werden knapp davor, im Bühnenraum, Turnringe schwingen an langen Seilen, sodass der junge Kerl, der an ihnen hängt, richtig ausholen kann.
Zeit ohne Gefühle – eine Erzählung aus Feldafing und über uns alle lautet der Titel des Stücks. Geschrieben hat es die Münchner Autorin Lena Gorelik in enger Zusammenarbeit mit der Regisseurin Christine Umpfenbach, die es auch (dokumentarisch) inszenierte. Als Uraufführung eröffnete es das mehrwöchige Programm »Wohin jetzt? – Jüdisches (Über)leben nach 1945«, initiiert von den Münchner Kammerspielen und dem Institut für Neue Soziale Plastik.
Basierend auf Dokumenten, Interviews, Briefen folgt das Stück keiner stringenten Handlung. Am Anfang steht Feldafing, in dem schon Kaiserin Sissi ebenso wie Thomas Mann vornehm residierten. Zeit ohne Gefühle zerlegt sowohl die Chronologie der historischen Ereignisse (sie wird aber von den Schauspielern ab und an sehr schulbuchmäßig vorgetragen) als auch jede aufkommende Idylle. Als Erzählstrang, der sich immer wieder einmal zeigt, führt Mordechai Teichners Überlebensgeschichte durchs Stück (Dramaturgie: Theresa Schlesinger).
Das DP-Lager Feldafing war zuvor eine NS-»Reichsschule«
Als 14-Jähriger kam Mordechai, der Auschwitz überlebt hatte, ins DP-Lager Feldafing, vormals eine »Reichsschule«, in der Jungen zur »NS-Führungselite« herangezogen wurden (und dazu gehörte auch der Turnsport). Mordechai geht später nach Israel, erzählt nicht viel und betritt nie wieder deutschen Boden.
Christine Umpfenbach hat selbst noch bis vor seinem Tod 2022 Interviews mit ihm geführt. Das Theaterprojekt wurde von Mordechais Sohn Meir Teichner, der ebenfalls in Israel lebt, begleitet. Zusammen mit dem Theaterteam hat er die Orte der Feldafinger Geschichte seines Vaters erkundet. Aufnahmen des Vaters wie des Sohnes sind als Videoeinspielungen Teil der Inszenierung.
Die Zeitebenen schieben sich ineinander. Das Bühnenbild (Nuphar Barkol) lässt mit wenigen Handgriffen schnelle Veränderungen zu. Die Vergangenheit wird mit der Gegenwart enggeführt, die Gefahr, die von dieser ausgeht, dem Publikum vorgehalten (auch durch eingespielte AfD-Zitate). Die Inszenierung stellt durch Verschränkungen in schnellem Tempo Beziehungen her, auch zwischen Leidensgeschichten, die natürlich Fragen aufwerfen und stark politisiert der Konzentration auf die »Erzählung« an (berührender) Kraft nehmen.
Und wenn wir keinen Juden im Ensemble haben?
Alles ist komplex. Erzählstrategie und die Bühnenabläufe zeigen das. Zusammenhänge erklärt das noch nicht. Immer wieder begeben sich die Darstellerinnen und Darsteller auf eine Metaebene, auf der eine nicht gespielte Welt vorgetäuscht wird mit Fragen und Sätzen, die heutige Diskussionen widerspiegeln: Sollte ein Jude nicht von einem Juden gespielt werden? Und wenn wir keinen Juden im Ensemble haben? Was bedeutet es überhaupt, wenn die Autorin jüdisch ist? Schließlich tauschen die (richtig tollen) Schauspieler – ein wenig erwartbar – Rollen auch einfach mal durch.
Nach der Premiere kommt Meir Teichner zum Abschlussapplaus mit auf die Bühne. Er ist gerührt. Und wenn er davon erzählt, wie sein Vater (»He was just a normal guy«) darauf geachtet habe, ja nichts Deutsches zu kaufen, ist man Mordechai Teichners Geschichte auf einmal sehr nahe und selbst berührt.
Weitere Aufführungen am 4., 12. und 19. Dezember