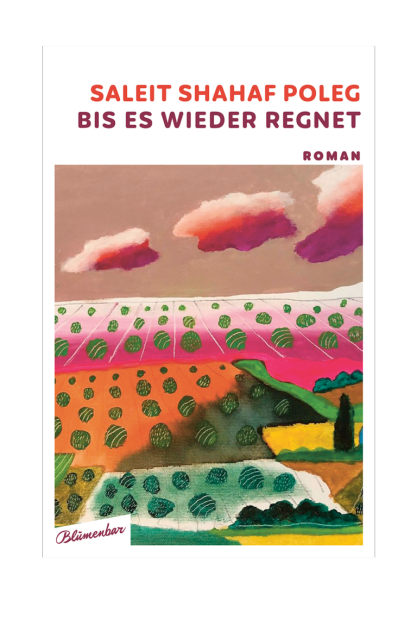»Wenn wir es nicht besser wüssten (…), könnten wir meinen, einer da oben wolle uns bestrafen.« In einem kleinen Dorf in der Jesreel-Ebene hat es seit zwölf Jahren nicht mehr geregnet. Alle warten – doch der Regen kommt nicht. Drei Herbstmonate lang.
»Keinen einzigen Gerechten gibt es in dieser ganzen Jesreel-Ebene – das wissen wir. Aber so eine Strafe – mit anzusehen, wie die Felder darben, winzige Käfer die Luzerne befallen, fette Raupen an den faulenden Maisstengeln knabbern, der dürstende Weizen verdorrt, die Orangenbäume welken, Hühner und Kühe vorzeitig geschlachtet werden, weil es an Futter mangelt – diese Strafe haben wir nicht verdient.«
Die israelische Schriftstellerin Saleit Shahaf Poleg erzählt in ihrem Debütroman Bis es wieder regnet von drei Generationen in einem Kibbuz. Die Jesreel-Ebene, eine Urzelle des jüdischen Staates, gilt im modernen Israel als fast mystische Gegend. Im 19. Jahrhundert, lange vor der Staatsgründung, legten dort die ersten Pioniere die Sümpfe trocken und ließen sich nieder. In dieser Gegend siedelt Poleg ihren Roman an.
Im Zentrum stehen die beiden Schwestern Jaeli und Gali
Im Zentrum stehen die beiden Schwestern Jaeli und Gali, die in den Kibbuz zurückkehren. Die eine ist aus Tel Aviv weggezogen und möchte wieder aufs Land, die andere reist aus Kanada an. Beide haben den Kibbuz vor Jahren verlassen, traten aus der Gemeinschaft aus und wollten nie wieder zurück.
Nun ist Jaeli schwanger und möchte aus dem Haus ihrer verstorbenen Tante ein Gästehaus machen. Ihre Schwester Gali will unter dem Pampelmusenbaum im Hinterhof des Familienhauses heiraten – doch der Bräutigam lässt auf sich warten, und es ist ungewiss, ob die Hochzeit überhaupt stattfindet.
Die beiden Frauen stoßen im Kibbuz auf Ablehnung – und auf Korruption. Anders als in der Gründungszeit scheint es heute nichts Heldenhaftes mehr im Kibbuz zu geben, er ist kein Modell kameradschaftlichen Zusammenlebens mehr. Im Gegenteil, es geht nur allzu menschlich zu: Es gibt Lügen, Neid und starke Eigeninteressen.
Die heute 46-jährige Poleg scheint zu wissen, wovon sie schreibt, sie verbrachte ihre Jugend in einem Kibbuz in der Jesreel-Ebene. Doch ihr Roman ist keine Abrechnung. Sie schreibt weder anklagend noch sentimental darüber, dass die Ideale der Gründergeneration verschwunden sind. Sie schildert das raue Klima im Dorf und lässt nüchtern und geradezu beiläufig einfließen, dass die Lebensform Kibbuz möglicherweise nicht mehr zeitgemäß ist.
Poleg entwickelt ein Tableau, auf dem sie die Geschichte wie in einem Kaleidoskop aus verschiedenen Perspektiven zeigt: vor allem aus denen der beiden zurückkehrenden Frauen und ihrer Großeltern Sophia und Joske, die einander angiften. Diese vielen Perspektiven machen den Roman zu einer besonderen Lektüre. Es mag am Anfang etwas verwirrend sein, die verschiedenen Protagonisten, die jeweils in Kapiteln zu Haupthelden werden, kennenzulernen und sich in die Gesamterzählung hineinzufinden. Doch gerade dies verleiht dem Buch Tiefenschärfe und ermöglicht es Poleg, das Innenleben ihrer Charaktere vor dem Hintergrund des Dorflebens tief auszuleuchten.
In Israel erhielt das Buch den Preis des Kulturministeriums für das Debüt des Jahres
Sehr bildreich beschreibt sie Gerüche, die Landschaft, das Wetter und führt den Leser in die Welt des Kibbuz ein. Dies gelingt ihr in einer frischen, sehr heutigen Sprache, die manchmal poetisch ist und an anderen Stellen geradezu salopp. In Israel erschien das Buch 2021 und erhielt den Preis des Kulturministeriums für das Debüt des Jahres. Am Ende des Romans platzt zwar die Hochzeit – aber es regnet wieder, und manches, was vorher verborgen war, wird plötzlich sichtbar.
Durch das gesamte Buch zieht sich ein Geheimnis. Poleg verknüpft es gekonnt mit einer Entscheidung, die sie Jaeli im ersten Drittel des Romans fällen lässt. Im Laufe der Erzählung machen einzelne Kibbuz-Bewohner immer wieder vage Andeutungen, doch wird das Geheimnis – das auch hier nicht verraten werden soll – erst am Ende gelüftet.
Das sensible Thema, das sich dahinter verbirgt, böte viel Stoff für einen weiteren Roman. Hoffentlich greift Poleg es noch einmal auf. Sie würde den Lesern und einer wichtigen gesellschaftlichen Debatte, sowohl in Israel als auch in Deutschland, einen Dienst erweisen.
Saleit Shahaf Poleg: »Bis es wieder regnet«. Roman. Übersetzt von Ruth
Achlama. Aufbau, Berlin 2023, 300 S., 23 €