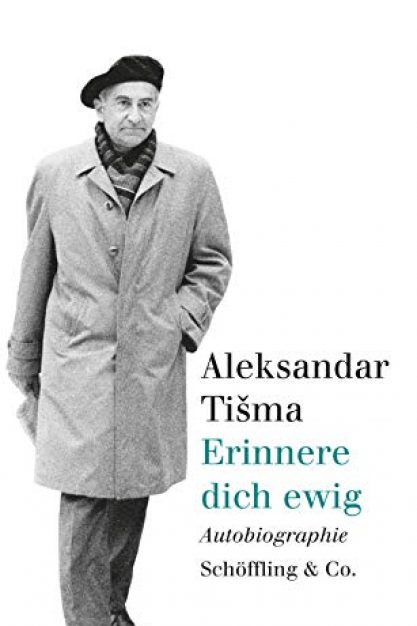Als im November 1991 die hochbetagte Mutter des Schriftstellers Aleksandar Tisma im Sterben liegt, zeigt der Fernseher im Pflegeheim der serbischen Stadt Novi Sad das quasi erste Kapitel des neuen Krieges. Es ist nicht sicher, ob die Greisin davon noch etwas mitbekommt oder ob sie sich an einen ganz anderen Krieg, an eine andere Zeit erinnert, wenn sie ihren Sohn, der auch bereits 67 Jahre alt ist, mit leiser Stimme fragt: »Sag, lassen sie dich in Ruhe?«
Aleksandar Tisma, geboren 1924 im Vojwodina-Städtchen Horgos und aufgewachsen in jenem damals noch multiethnischen Novi Sad, ist der Sohn einer serbischen Jüdin und eines orthodoxen Serben, die wohl beide nicht allzu gläubig waren. Die Mutter war vor der Heirat problemlos zum Christentum übergetreten, auch erinnert sich der Sohn später an das »laue Serbentum« seines Vaters. Mit der deutschen Übersetzung von Tismas Autobiografie Erinnere dich ewig erscheint nun, 18 Jahre nach dem Tod des Autors, das persönlichste Buch eines Jahrhundertzeugen, der hierzulande erst spät entdeckt wurde – in den 90er-Jahren und quasi als literarische Nebenfolge der Jugoslawienkriege.
GESCHEHEN Doch Ironie der Geschichte: Bereits in jenen Jahren hatte sich der dezidiert »nicht dazugehörige« Tisma, dem die Welt unvergessliche Romane wie Der Gebrauch des Menschen, Das Buch Blam oder Treue und Verrat verdankt, komplett ausgeschrieben gefühlt – und vermutlich auch überfordert angesichts bohrender westlicher Mediennachfragen nach seiner Position zum aktuellen Geschehen. Obwohl er damals den Massenmörder Milosevic in keiner Zeile verteidigte und auch sein Hinweis auf den dubiosen Stolz zahlreicher Kroaten auf »ihre« faschistische Ustascha-Weltkriegsmiliz hochplausibel war – mitunter blieb ein schaler Nachgeschmack von Relativierung und seltsam anmutenden Ressentiments gegenüber dem Westen. Trug dieser tatsächlich Mitschuld am Zerbrechen des Vielvölkerstaates, der sich doch bereits selbst zerlegt hatte, nationalistisch erhitzt und gleichzeitig ökonomisch vollständig ausgepowert?
Es war für ihn wichtig, ja überlebensnotwendig, »in Ruhe gelassen« zu werden.
Dabei war Aleksandar Tisma einst, nachdem er mit unendlich viel Glück den Zweiten Weltkrieg überlebt hatte, in den ersten Jahren jenes Tito-Jugoslawien geradezu davon besessen, nach Westeuropa zu gelangen. Nur dort, glaubte er damals, würde er die Kraft finden, seine Bücher zu schreiben und literarisch Zeugnis zu geben. Da es doch für ihn seit jeher extrem wichtig, ja überlebensnotwendig war, »in Ruhe gelassen« zu werden: bereits im Gymnasium als »Halbjude« und dann während der ungarischen Besatzung Novi Sads und jener berüchtigten Razzia vom Januar 1942, bei der innerhalb von drei Tagen Tausende Juden erschossen, erschlagen und in der Donau ertränkt worden waren.
ISOLIERTHEIT Unter dem Radar galt es danach auch im nahe gelegenen Budapest des Horthy-Regimes zu bleiben, sich beim Pendeln zwischen beiden Städten nicht erwischen zu lassen, auch auf die geliebte Großmutter und die Mutter Obacht zu geben – doch bei alldem stets dem Schreiben Priorität einzuräumen und der Obsession, en masse flüchtige Liebschaften zu beginnen. Schonungslos vor allem gegen sich selbst, seziert Tisma in der Rückschau jenes damalige Amalgam, werden Motivationsbündel zu Erzählsträngen, jedoch nie zu einem Heldenlied. »Die geografische Lage war eine schicksalshafte Tatsache; sie fesselte mein Leben an totalitäre Regimes, die unser Jahrhundert beherrschten.« Die »äußerste Isoliertheit wegen meiner gemischten Herkunft« wird dabei zeitlebens Tismas Blick auf Kollektive und auf Einzelne schärfen, die nicht zu standhaften Individuen hochgejubelt, sondern in ihrer ganzen Ambivalenz beschrieben werden.
Diese Autobiografie, die von den lebensweltlichen Umständen spricht, die zur Entstehung eines literarischen Werks geführt haben, das sich mit jenem von Imre Kertész durchaus messen kann, ist dabei alles andere als ein Appendix, der nur für jene von Interesse wäre, die Tismas Romane über das Sterben und Überleben in Novi Sad, Belgrad und Budapest bereits kennen. Auch in eigener Sache nämlich ist er ein illusionsloser Beobachter dessen, was geschieht, wenn der »Gebrauch des Menschen« einsetzt – und dies nicht nur zu Zeiten tödlicher Verfolgung. Inkohärenz, Ungleichzeitigkeiten, Widersprüche, mehr Egoismus denn Altruismus, Lebensgier und Angst (Tisma selbst spricht schonungslos von »Feigheit«), bewusste oder unbewusste Illoyalität gegenüber diversen »Identitäten« – all das wird in diesen völlig uneitlen Memoiren weder verdrängt noch psychologisierend hin und her gewendet.
HEIMAT Denn selbstverständlich konnte ihm auch das Tito-System keine wirkliche Heimat sein: »Die Kommunisten hatten ein Gespür dafür, wer zu ihnen hielt und wer nicht, weil sie sich mit dieser Entscheidung am meisten befassten.« Repression und Gemütlichkeit, die ersten Auslandsreisen und die ersten Risse im Konstrukt von Tito-Jugoslawien: Der Schriftsteller beobachtet es im Wissen, dass das Kommende nicht unbedingt besser sein wird. Würde man ihn, wie es die Mutter so sehr wünschte, auch weiterhin »in Ruhe lassen«, da seine Position doch stets ein solitäres Dazwischen ist? (Durchaus irritierend: Frau und Sohn kommen in seiner Autobiografie eher sporadisch vor.)
»Es ging um mein Judentum, um die Hälfte meiner Person, die ich zu verbergen bemüht war, zuerst als junger Mensch, den die jüdische Herkunft daran hinderte, sich mit seiner Umgebung eins zu fühlen, später weniger bewusst, auch als Schriftsteller, der seine Figuren allgemein, nicht ethnisch kennzeichnet, sie nicht mit ihrer Umgebung als verschmolzen darstellen wollte.« Aus diesem Zögern und Nicht-verschmelzen-Können hat Aleksandar Tisma Weltliteratur gemacht und Novi Sad damit auf die romaneske Landkarte gebracht, gleichrangig mit Svevos Triest, Joyces Dublin und Prousts Paris. Höchste Zeit, sein auf Genauigkeit und Distanz rekurrierendes Werk neu zu entdecken.
Aleksandar Tisma: »Erinnere dich ewig. Autobiographie«. Aus dem Serbischen von Mirjana und Klaus Wittmann. Schöffling & Co., Frankfurt 2021, 311 S., 24 €