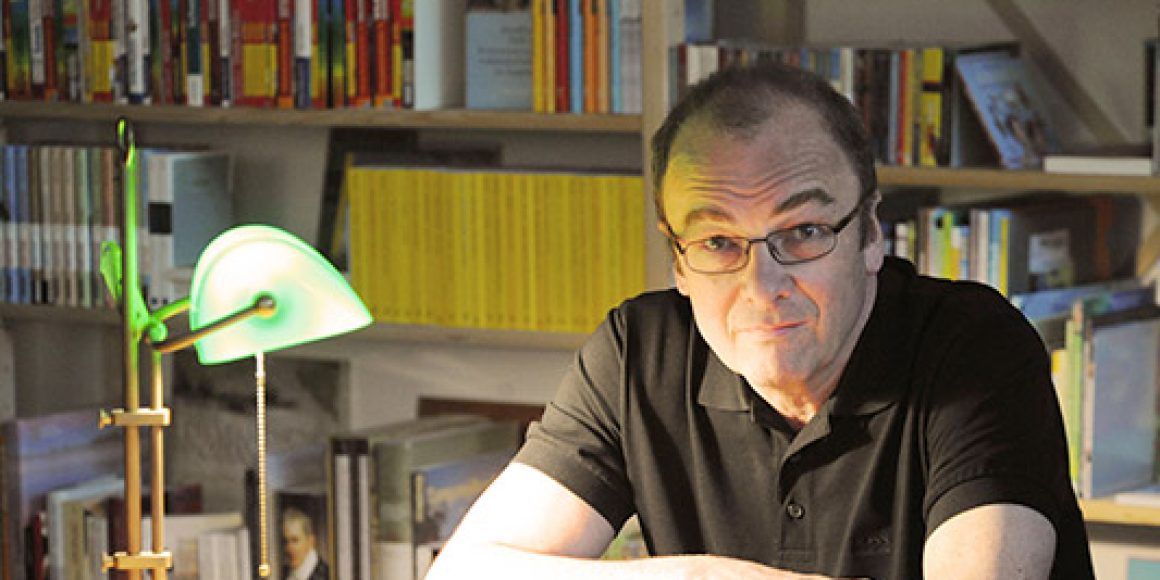Herr Menasse, am Sonntag entscheidet sich, ob Frankreich künftig von Marine Le Pen und ihrem Front National regiert wird. In anderen europäischen Staaten wie Polen oder Ungarn sind die Rechtspopulisten schon an der Macht. Ist damit die Idee eines geeinten Europas, das den Nationalismus überwindet, gescheitert?
Wir haben gerade in Europa 60 Jahre nachnationale Entwicklung gefeiert. Das ist ein realer historischer Prozess an einem konkreten Ort. Europa ist also keine Utopie. Es ist aber ein unvollendetes Projekt. Der neue Nationalismus ist eine Transformationskrise. Die nachnationale Union funktioniert auf halbem Wege noch nicht. Jetzt wollen viele das Rad zurückdrehen, weil sie sich ein nachnationales Europa nicht vorstellen können. Sie haben kein Bild von der Zukunft, allerdings haben sie auch die Geschichte verdrängt – der neue Nationalismus ist ein Abgrund zwischen Gestern und Morgen.
Haben Sie den mobilisierbaren Rassismus unterschätzt, oder wurde berechtigte Kritik an der EU und ihren Institutionen bloß den Falschen überlassen?
Alle Politiker müssen die Fiktion aufrechterhalten, dass sie nationale Interessen verteidigen, weil sie ja nur national gewählt werden. Das ist der Grundwiderspruch der EU: Die Staaten haben in vielen Bereichen bereits nationale Souveränitätsrechte abgegeben, nur die politische Verantwortung wird immer noch national organisiert. Dieser unproduktive Widerspruch ist die ganze Krise. Die Vertreter der Nationen im Rat blockieren europäische Entscheidungen, dann sagen sie, die EU funktioniere nicht, wir müssen nationale Lösungen finden, aber die funktionieren erst recht nicht.
Ein Teufelskreis ...
... ja, und die Gefahr ist, dass die Wähler dieser Politiker bald sagen werden: Diese Vertreter unserer Nation sind nicht konsequent genug, wir brauchen konsequentere Nationalisten. So entsteht eine Spirale, die im Faschismus endet.
Der EU wird oft Dysfunktionalität vorgeworfen. Überstaatliche Einrichtungen wie die UN sind bei internationalen Konflikten machtlos. Bergen überstaatliche Einrichtungen am Ende mehr Gefahren als nationale?
Internationale Organisationen wie die UNO können nicht funktionieren. Stichwort Israel: In der UNO sitzen die Freunde Israels und die Feinde Israels. Na und? Was jetzt? Eine Versammlung von Vertretern von Staaten ist keine Gemeinschaft. Schon der Völkerbund hat nicht funktioniert. Friedensverträge zwischen Nationen haben keinerlei Frieden gesichert, Bündnisse zwischen Nationen haben nicht gehalten, Resolutionen von Nationen an Nationen sind folgenlose Stoßgebete. Die einen haben ein Vetorecht, andere sitzen dabei und haben keinen Einfluss. Am Anfang ist die große Hilflosigkeit, am Ende die Betroffenheit über die Folgen der großen Hilflosigkeit. Aber die EU hat ja eine ganz andere Idee: Dass sie schlecht funktioniert, und manchmal gar nicht, liegt daran, dass auch innerhalb der EU der Nationalismus noch zu stark ist.
Ist der Nationalismus für Sie gleichbedeutend mit dem Rechtspopulismus?
Es gibt keinen Rechtspopulismus ohne Nationalismus. Das kann man nicht voneinander trennen. Das Problem ist heute allerdings, dass auch die Parteien der Mitte in die Nationalismusfalle tappen. Die Sozialdemokraten, einst Internationalisten, verteidigen heute die nationalen Arbeitsmärkte. Das ist europapolitisch ein Skandal. Die Konservativen verteidigen die nationale Steuerhoheit, wodurch die multinationalen Konzerne die europäischen Staaten gegeneinander ausspielen können. Das führt zu Steuerdumping, dadurch fehlt Geld in den Budgets aller Staaten, es fehlt in den Sozial-, Bildungs- und Gesundheitssystemen. Das schadet allen europäischen Bürgern.
Der Nationalismus kommt also nicht von Rechtsaußen.
Er kommt aus der Mitte, von den Christ- und Sozialdemokraten, weil sie national gewählt werden wollen. Die Rechtspopulisten sind nur deren Lautsprecher.
Woher nehmen Sie Ihren EU-Optimismus? Liegt es daran, dass in Österreich vor nicht allzu langer Zeit das Übel FPÖ mit einem möglichen Bundespräsidenten Norbert Hofer knapp vermieden wurde?
So optimistisch bin ich auch wieder nicht. Dass in Österreich verhindert wurde, dass der FPÖ-Kandidat Präsident wurde, würde mich erst dann beruhigen, wenn die anderen Parteien eine Lehre daraus zögen. 30 Prozent wählen diese unter Faschismusverdacht stehende Partei. Jeder nicht-freiheitliche Politiker sollte rechnen können: 70 Prozent wollen die nicht! Ich muss unter diesen 70 Prozent eine Mehrheit bekommen! Aber sie versuchen, die 30 Prozent zu befriedigen, die freiheitlich gewählt haben. Sie werden so nie mehr eine aufgeklärte Mehrheit bekommen.
In ganz Europa nehmen antisemitische Übergriffe zu. In Berlin wurde vor Kurzem ein jüdischer Schüler so stark judenfeindlich gedemütigt, dass er die Schule verlassen musste. In Österreich ist es ähnlich. Wie ist es bei Ihnen persönlich: Fühlen Sie sich als Jude in Österreich sicher?
Der Antisemitismus, den ich erlebe, ist kindisch. Etwa, wenn mir Anhänger der FPÖ schreiben: »Missgeburt, geh’ zurück nach Israel!« Aber haben sie Macht, die mich wirklich bedrohen kann? Das glaube ich nicht. Sehr bedrohlich ist etwas anderes, etwas Neues.
Welche Gefahr meinen Sie?
Die Gefahr des importierten Antisemitismus, der durch den politischen Islam nach Europa gekommen ist. Zugleich wendet sich jetzt der »klassische« Antisemitismus strukturell auch gegen neue Feindbilder: Muslime und Flüchtlinge. Es ist derselbe Mechanismus zur Herstellung nationaler Wir-Gruppen, nur mobilisiert er jetzt nicht einen latenten Judenhass, sondern die virulente Islamophobie und Fremdenangst. Das müssen wir verstehen, und das ist zugleich die Falle: Wir müssen den Antisemitismus dort, wo er sich jetzt zeigt, bekämpfen, ohne die Islamophoben zu bestärken, und wir müssen den Rassismus in Gestalt des Antiislamismus bekämpfen, ohne Verharmloser des politischen Islam zu werden.
Mit dem Schriftsteller und Autor des Buches »Der europäische Landbote. Die Wut der Bürger und der Friede Europas« sprach Anina Valle Thiele.