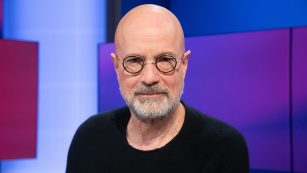Frau Lustiger, Sie beschreiben in Ihrem Buch »Erschütterung«, wie Sie nach den Attentaten in Paris im November 2015 nachrichtensüchtig alle Ereignisse mitverfolgt haben. Sind Sie schon wieder auf Entzug?
(Lacht.) Ich lese immer sehr viel. Das habe ich mir bei meinem Vater, den ich sehr verehrt habe, abgeschaut. Er las Zeitungen in vielen Sprachen. Es ist spannend, zu sehen, wie Ereignisse von der linken und rechten Presse jeweils unterschiedlich kommentiert werden und welche unterschiedlichen Gewichtungen sie in den verschiedenen Ländern bekommen.
Die Sucht nach Nachrichten ist ja eine Sucht nach Wissen, nach Verstehen. In Ihrem Essay haben Sie versucht, zu verstehen. Was hat Sie denn am meisten erschüttert?
Dass ein Mensch einen anderen Menschen umbringt. Dass einer beschließt, dass ein anderer den Tod verdient. Ich habe zunächst versucht, alle Fakten in Erfahrung zu bringen: Wie, wo und wann wurden Menschen getötet? Dabei habe ich übrigens auch den Hyperrealismus in den Medien bemerkt. Wir alle waren süchtig nach Neuigkeiten, auch wenn sie keinen wirklich relevanten Informationsgehalt besaßen.
Sie versuchen in Ihrem Buch, eine im Grunde mittelalterliche Gewalt mit dem Blick eines aufgeklärten, liberalen Menschen zu verstehen. Fällt Ihnen das nicht schwer?
Das ist es ja gerade, was diese Dschihadisten bezwecken wollen: dass sich die Zivilgesellschaft aufspaltet. Das sollten wir gerade nicht tun. Die Terroristen erklären unserer Zivilgesellschaft den Krieg. Aber was macht sie aus? Was verteidigen wir eigentlich? Um zu verstehen, was uns ausmacht, habe ich wieder Voltaire, Richard Sennett, Marcel Mauss, Hannah Arendt, Ernst Bloch gelesen.
Viele französische Juden haben genug, wandern nach Israel aus. Haben Sie Angst, denken Sie selbst darüber nach?
Ich habe als Jüdin keine Angst, weil ich nicht orthodox bin. Meine Kinder sind in keine konfessionelle Schule gegangen und ich in keinen koscheren Supermarkt. Aber wenn man seine Kinder in eine Schule bringen muss, vor der Militär steht, wenn man als Mann überlegt, ob man in der Metro eine Kippa tragen soll, dann ist das eine andere Geschichte. Ich glaube jedoch, viele wandern nicht nur aus, weil sie Angst haben, sondern auch, weil sie die Gleichgültigkeit, mit der ihrer Bedrohung begegnet wurde und wird, schockiert hat. Diese Gleichgültigkeit gegenüber ihrem Schicksal schmerzt sie fast so sehr wie die zahlreichen antisemitischen Übergriffe. Die Zivilgesellschaft hat schlechten Gewissens hingenommen, dass Karikaturisten, Journalisten und Juden getötet wurden. Mit den Attentaten vom 13. November hat sich die Einstellung zum Terror verändert. Plötzlich ist die ganze Gesellschaft bedroht. Plötzlich sind alle betroffen. Ich erzähle im Buch eine Begebenheit: Wie ich am Tag nach den Attentaten eine alte Bekannte anrief, die die Lager überlebt hat. Sie sagte mir: »Jetzt sind wir alle Juden.«
Seit dem Attentat hält der Ausnahmezustand in Frankreich an, bis heute. Wie empfinden Sie das?
Was ich viel schlimmer finde, ist, dass Präsident Hollande gleich am nächsten Tag gesagt hat, Frankreich befinde sich im Krieg. Ich zitiere in meinem Buch Ernst Bloch: »Ein Haifisch und ein Elefant können sich nicht begegnen und keinen Krieg führen. Aber schon, was im selben Wasser lebt, hat (…) eine Einheit, in der Krieg oder Verstehen möglich ist.« Dass man gegen Terror vorgehen muss, ist doch klar. Aber der sogenannte Islamische Staat ist eine Terrororganisation, und wir sind demokratische Länder. Wir werden nie in einem Wasser leben. Und wir sollten daher die Rhetorik einer Terrororganisation nicht übernehmen.
Wie würden Sie es dann bezeichnen, wenn nicht als Krieg?
Was man bei solchen Argumenten vergisst, ist, dass die Terroristen Franzosen sind. Hier haben Franzosen Franzosen umgebracht. Muslime und Konvertiten, die in Deutschland, Frankreich, England aufgewachsen sind, beschließen, »Soldaten des Kalifats« zu werden. Es sind Menschen, die aus Ländern mit Kindergeld kommen, mit Studienunterstützung, mit Arbeitslosengeld. Wie ist so etwas möglich? Wer indoktriniert sie? Wer finanziert sie? Warum lassen sie sich radikalisieren? Was macht junge Menschen anfällig für diesen neuen Faschismus? Das sind die großen Fragen, von denen man ablenkt, wenn man über Krieg spricht.
Kommen Sie denn zu einer Erklärung?
Es kam gleich in den Tagen nach den Anschlägen zu Maßnahmen. Auch, weil wir verunsichert waren. Es ist eben eine Zeit, in der jeder sofort Antworten hat. Und gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, erst einmal die richtigen Fragen zu stellen, zu verstehen versuchen, worum es hier eigentlich geht.
Muss man vielleicht sagen, es liegt in der Natur des Menschen, dass Integration – trotz aller Bemühungen – scheitert, dass Menschen verschiedener Kulturen einfach nicht zusammenleben können?
Nein. Sehen Sie sich die Opfer an. Das ist ja gerade das Verrückte an diesen Attentaten, der sogenannte Islamische Staat hat zwar den Reichen und den Mächtigen den Krieg erklärt. Tatsächlich haben sie aber ihresgleichen ermordet. Die Opfer kamen aus über 50 Kommunen und aus 17 verschiedenen Ländern. Sie waren jung, hatten Berufe, Freunde, Zukunftsträume. Mörder bleiben eine kleine Minderheit. Sie richten nur sehr viel Schaden an. Von der breiten Masse, die ein ruhiges und gutes Leben führt, hat man nun leider erfahren, denn sie sind die Opfer.
Sie sprechen in Ihrem Essay auch die Flüchtlingskrise an. Es klingt, als stimmten Sie Kanzlerin Merkel zu, die sagte: »Wir schaffen das«.
Ich habe damals die Bilder von den Flüchtlingen angesehen, die »Merkel, Merkel« oder »Deutschland, Deutschland« skandiert haben, als wäre es das gelobte Land, und gleichzeitig auch Bilder von Deutschen gesehen, die an den Bahnhöfen und Flughäfen standen und bei der Ankunft der müden Flüchtlinge klatschten. Im Nachhinein wird mir bewusst, dass dieser Enthusiasmus auf beiden Seiten eigentlich ein Warnzeichen hätte sein müssen. Die Deutschen haben die Flüchtlinge auf die Erfahrung der Flucht reduziert. Und die Flüchtlinge haben die Deutschen nur als ihre Retter erachtet. Dann kam das Erwachen. Plötzlich wurde man notgedrungen von der Realität eingeholt. Und natürlich traten kulturelle Differenzen zutage. Und plötzlich sprachen in Deutschland alle von der Leitkultur.
Und was ist die Leitkultur?
Die Grundrechte. Wenn wir uns auf sie berufen, dann verheddern wir uns nicht. Dann wissen wir, was unser Rückgrat ist. Zum Beispiel, dass Männer und Frauen in Deutschland gleichberechtigt sind. Dass die ungestörte Religionsausübung gewährleistet wird. Dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt werden darf. Dass jeder das Recht hat, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Die Grundrechte wurden am 8. Mai 1949 nach einem Weltkrieg und der Schoa beschlossen. Sie sind unabänderlich. Und sie bestimmen unser Zusammenleben.
Mit der Schriftstellerin sprach Lissy Kaufmann.
Gila Lustiger: »Erschütterung. Über den Terror«. Berlin Verlag, Berlin 2016, 160 S., 16 €